William Turner ist eine der merkwürdigsten Personen der Kunstgeschichte: Geboren noch im 18. Jahrhundert, scheint sein umfangreiches Werk auf viel spätere Zeiten vorauszuweisen.
Turner war ein Anti-Klassizist – dazu erklärte ihn besonders der große Kunstschriftsteller John Ruskin (1819–1900), ein entschiedener Gegner des Klassizismus, der Turners Lob in dem fünfbändigen „Modern Painters“ sang.
Heute wird Ruskins Bewunderung für den Meister weitgehend geteilt: Turners Werk wies weit in die Zukunft. Und das, obwohl Turner Anregungen früherer Kunstepochen aufgriff. Aber angesichts der Farbexplosionen seiner großen Gemälde denkt mancher, der Meister aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts habe den Impressionismus oder gar den abstrakten Expressionismus vorweggenommen! Ein genaueres Hinsehen zeigt allerdings, dass er doch ganz und gar ein Mensch seiner Zeit gewesen ist.
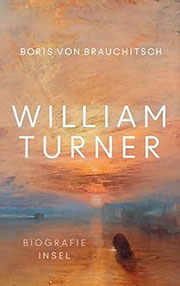 Das Leben des großen Künstlers schildert der Fotografie- und Kunsthistoriker Boris von Brauchitsch, der zuvor schon andere Biografien vorgelegt hat (Michelangelo, Caravaggio, Friedrich), in einem konzentrierten, sehr gut lesbaren Buch von 237 Seiten. Gelungen sind dem Autor besonders seine Bildbeschreibungen und Interpretationen. Die immerhin zahlreichen Abbildungen dienen zu wenig mehr als der Orientierung – sie sind schlicht zu klein.
Das Leben des großen Künstlers schildert der Fotografie- und Kunsthistoriker Boris von Brauchitsch, der zuvor schon andere Biografien vorgelegt hat (Michelangelo, Caravaggio, Friedrich), in einem konzentrierten, sehr gut lesbaren Buch von 237 Seiten. Gelungen sind dem Autor besonders seine Bildbeschreibungen und Interpretationen. Die immerhin zahlreichen Abbildungen dienen zu wenig mehr als der Orientierung – sie sind schlicht zu klein.
1775 in London geboren, begann Turners Weg zur Kunst durchaus konventionell – auf einer Akademie. Ganz am Anfang arbeitete er allerdings, vierzehnjährig, als Zeichner in einem Architektenbüro, wo er also eben das bieten musste, was er selbstverständlich beherrschte, woran ihm aber später überhaupt nicht mehr viel lag: Präzise Linien und korrekte Perspektiven. Schon sehr bald darauf durfte er die Royal Academy besuchen, wo er zunächst Aquarelle schuf – nach von Brauchitsch die perfekte Technik bereits für den noch ganz jungen Künstler, denn „sie vereint Licht, Materie und Wasser, steht für Transparenz und Luzidität“ (18). Es ist ja wahr: Eben das sollte das Werk noch des späteren, des reiferen Künstlers dominieren – auch in seinen Ölgemälden.
Was wurde auf der Akademie nicht gelehrt? Was war nicht respektiert? Die Landschaftsmalerei! Also eben das, worin Turner reüssierte, nein, worin er es zur absoluten Meisterschaft brachte und womit wir ihn bis heute in Verbindung bringen. Wenn wir dem Autor folgen, dann konnte ein Besuch der Akademie ein paradoxer Grund sein, warum Landschaftsmalerei es in England zur Blüte brachte: Weil das Abkonterfeien einer Landschaft nicht so funktionierte wie das Abzeichnen einer Gipsbüste. Jeder Künstler musste notgedrungen seinen eigenen Weg finden.
Turner muss ein sehr ehrgeiziger Mensch gewesen sein, der sich immer wieder mit anderen Künstlern verglich und sich selbst als Konkurrenten von Claude Lorrain (1600–1682) sah, dem großen französischen Landschaftsmaler. Der allerdings hatte es, anders als der auch Katastrophen darstellende Turner, vor allem auf Idyllen und Pastoralen abgesehen, die es in dieser Weise im Werk des Engländers nicht gibt. Und trotzdem: Wer Turners Gemälde mit jenen Lorrains vergleicht, dem kann ihre Ähnlichkeit nicht entgehen, die vor allem auf einer ähnlichen Malweise beruht, auf der Vorliebe für das Duftige und Atmosphärische, auf die ineinander verlaufenden Gestalten und Farben. In diesen Bildern – zum Beispiel schon in den „Ruinen der Abteil Tintern“, einem frühen Bild des Neunzehnjährigen – fühlt man sich tatsächlich an Lorrain erinnert. Von Brauchitsch spricht bei diesem Bild von einer „zarten und atmosphärischen Konstruktion“. Für ihn sind Turners Ruinenbilder „weniger Symbole als vielmehr Anschauungsobjekte“. Gilt das nicht für alle seine Bilder?

William Turner: The Burning of the Houses of Lords and Commons, 1834, Öl auf Leinwand, 92x123,2cm. Philadephia Museum of Art. Gemeinfrei
Allerdings malte Turner auch industrielle Häfen oder die Glut von Hochöfen – nicht, weil er die industrielle Revolution guthieß, sondern weil er sie zunächst und vor allem als ästhetisches Phänomen wahrnahm. Offensichtlich kam es ihm eben auf die Farben und ästhetischen Aspekte an, und Zeitkritik oder eine symbolische Bedeutung waren ihm eher gleichgültig. Wohl auch deshalb griff er gerne auf Zeilen von Gedichten zurück, die den Betrachtern helfen sollten, das Werk einzuordnen und zu verstehen.
Manchmal finden sich doch Symbole, aber es sind keine mit Ewigkeitsanspruch, sondern meist solche mit anekdotischem Charakter. So bildet sein Werk in vieler Hinsicht den Gegensatz zu jenem Caspar David Friedrichs, auch wenn ihre Motive gelegentlich dieselben waren. Zu Beginn seiner Laufbahn zeichnete oder malte Turner Ruinen – der Autor behandelt diese Bilder unter dem Titel des „Pittoresken“ –, aber sie besitzen niemals einen symbolischen Wert wie die ungefähr gleichzeitigen Bilder Friedrichs oder Carl Gustav Carus‘, die ja ihrerseits an die Literatur der Romantik anknüpfen konnten. Das gilt besonders für nächtliche Szenerien, in denen in den Bildern Friedrichs, Carus‘ oder Turners ganz ähnliche Phänomene auftauchen. Virtuos vermag schon der junge Turner die Zentrierung des Lichts auf die Mitte darzustellen, während die Dunkelheit zum Rand hin stetig zunimmt.
Immer wieder malte Turner auch Katastrophen. Zu großartigen Gemälden inspirierte ihn der Brand des Parlaments von 1834. Auf den Bildern sehen wir, wie die lodernde Glut im Wasser der Themse wetterleuchtet und nächtlich-blaue und feurig-rote Farben miteinander konkurrieren. „Die Verschmelzung der Elemente, das Flirrende, Heiße spiegelt sich im Feuchten“, schreibt der Autor und spricht von dem „explosiven, orgiastischen Charakter“ der Bilder. Aus seinem Buch lernen wir, dass Turner, immerhin Professor für Perspektive, die Brücke über die Themse um des dramatischen Bildcharakters wegen falsch darstellt. Das ist endlich einmal wirklich künstlerische Freiheit, wenn und weil ein Meister sich über Regeln hinwegsetzt…
 William Turner: The Fighting Temeraire tugged to her last Berth to be broken up, 1839, Öl auf Leinwand, 91×122 cm. National Gallery, London. Gemeinfrei
William Turner: The Fighting Temeraire tugged to her last Berth to be broken up, 1839, Öl auf Leinwand, 91×122 cm. National Gallery, London. Gemeinfrei
Ein weniger dramatisches als vielmehr melancholisches Bild ist „The fighting Temeraire“, das einen Veteranen der Schlacht bei Trafalgar auf seinem letzten Weg abbildet – von einem Schlepper gezogen, bewegt sich das alte Schlachtschiff zu dem Kai, an dem es abgewrackt werden soll. Für uns, die wir keine englischen Patrioten sind, ist der Himmel wichtiger, denn Turner zeigt nicht, wie so viele andere (wie fast alle…), bauchige Cumulus-Wolken, die aussehen, als seien sie am Himmel festgenagelt, sondern niedrige und strähnige Cirrus-Wolken, die vom Höhenwind minütlich verändert werden und eben damit für einen das Dynamische und Fluide abbildenden Maler viel interessanter sein müssen. Werner Busch zitiert in „Das unklassische Bild“, in dem er auf die Wolkenmalerei Turners und anderer Größen in extenso eingeht, aus der deutschen Übersetzung eines Lehrbuches von Pierre-Henri de Valenciennes (1750–1819), dem es darauf ankam, dass der Maler „die Natur auf frischer That erhascht“. Das hätte auch Turner sagen können. Deshalb tuschte er, wie es zuvor Valenciennes getan hatte, seine Aquarelle: es ging ihm um den Augenblick.

Pierre-Henri de Valenciennes: Skizze von Rocca di Papa (o.J.). zwischen 1775 und 1825, Öl auf Papier auf Karton, 16x29,5cm. Louvre Museum, Paris. Gemeinfrei
1840 wurde Goethes „Farbenlehre“ ins Englische übersetzt – eine Theorie, die mit der Bedeutung, die sie dem sinnlichen Sehen zuspricht, Turner weit entgegenkam. Worauf Goethe zielt, wird besonders deutlich, wenn er die symbolische Bedeutung der Farben von ihrem allegorischen, mehr konventionellen Gebrauch unterscheidet. Allegorie bedeutet für Goethe, dass mit einer Farbe ganz willkürlich eine Emotion oder ein sachlicher Bereich verknüpft wird, wogegen die symbolische Bedeutung mit dem Ausdruckscharakter der Farbe verknüpft ist. Seine Theorie zielte auf die Expressivität der Farbe: „Einen solchen Gebrauch also, der mit der Natur völlig übereinträfe, könnte man den symbolischen nennen, indem die Farbe ihrer Wirkung gemäß angewendet würde“. Diesem Satz konnte, nein musste ein Maler wie Turner unbedingt zustimmen. Dazu kam die vielfach dokumentierte Leidenschaft Goethes für Wolken und andere Himmelserscheinungen, mit der er Landschaftsmalern wie William Turner weit entgegenkam. Wie ihnen ging es Goethe um den Wechsel des Lichts und der Farben und damit um den Moment, wie wir insbesondere in Werner Buschs Buch nachlesen können.
Turner reiste exzessiv: Seine Fahrt den Rhein hinunter wurde berühmt – natürlich vor allem, weil sie sich in fantastischen Bildern spiegeln sollte –, die Berge der Schweiz beeindruckten ihn tief, aber zu seinem bevorzugten Sujet wurde schließlich Venedig, das sich seiner Art zu malen besonders fügte. Schon des vielen Wassers wegen! Turners Touren waren immer und ausschließlich – schon in seinen jungen Jahren, als er sich auf England beschränken musste – Arbeitsreisen, von denen er stapelweise Aquarelle mitbrachte, die er vor Ort angefertigt hatte. Ihm ging es um Veränderungen, um den Wandel und um das Dynamische, und so galt es schnell zu arbeiten. Die Stimmung eines Augenblicks sollte eingefangen werden. Und eben an dieser Absicht macht Werner Busch das „Unklassische“ seines Werkes fest. Von Brauchitsch weist daraufhin, dass diese Aquarelle, die ja nur Studien, also nicht für Ausstellungen gedacht waren, im Nachhinein den Eindruck des Hingeschluderten hervorriefen. Aber so wollte Turner laut von Brauchitsch keinesfalls verstanden werden. Seine Skizzen waren für ihn selbst gedacht, nicht für seine Bewunderer. Sie waren Teil seines Arbeitsprozesses, in dem es um die Abbildung von kurzen Augenblicken ging.
Einen William Turner durfte man nicht so ohne weiteres besuchen, sondern den Eintritt in sein Haus gestaltete der Künstler als einen „Reinigungsprozess für die Augen“. Deshalb wurden seine Besucher zunächst in ein dunkles Zimmer geführt, bevor sie sein Atelier betreten durften. „Die Schleuse aus Dunkelheit zwischen Außenwelt und Künstleratelier“, so deutet von Brauchitsch dieses Ritual, „sollte wie eine erfrischende Phase des Schlafs wirken, beruhigen und zugleich Lust darauf machen, wieder sehen, wieder etwas sehen, wieder etwas neu sehen zu können.“ Das zeigt deutlich, dass es Turner tatsächlich auf das physische Sehen ankam, auf das bloße Hinschauen, unbeeinflusst von Ideologien oder Überzeugungen. (Goethe ging ähnlich vor, wenngleich mit anderen Mitteln, wie wir aus Eckermanns Schilderungen wissen.) Ging es Turner also weniger um Gegenstände, Landschaften oder Vorgänge, sondern um das Hinschauen selbst? Bei Werner Busch lesen wir, dass Turner „die Erfahrung von Erscheinung“ darstellen wollte – eben abseits der Konvention.
Mir gefällt diese Biografie. Sie ist angenehm zu lesen und bietet eine gute Gelegenheit, sich mit einem großen Künstler zu beschäftigen, mit einem Giganten der bildenden Kunst.
Boris von Brauchitsch: William Turner. Biografie.
Insel Verlag 2024
256 Seiten mit 105 Illustrationen
ISBN 978-644705
Weitere Informationen (Verlag)
Werner Busch, Das unklassische Bild. Von Tizian bis Constable und Turner
Beck Verlag 2009
352 Seiten mit 134 Abbildungen
ISBN 978-3406582462
Lesen Sie zu Büchern von Boris von Brauchitsch auch:
Ein Buch gewoben aus Biografie und Fotografie.
Geschrieben von Boris von Brauchitsch und Sebastian Castro - 08.06.2009
„Leichte Fieberanfälle. Dauerregen“ – Eine neue Biografie zu Lesser Ury
Geschrieben von Mirjam Kappes - 09.08.2013
Ars apodemica – Foto-Text-Reisen mit Boris von Brauchitsch
Geschrieben von Claus Friede - 20.09.2016



Kommentar verfassen
(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)
Kommentare powered by CComment