Der deutsche Philosoph Wolfgang Welsch wählt für sein neues Buch im Haupttitel eine These – „Wir sind schon immer transkulturell gewesen“ – und für den Untertitel einen bezeichnenden Zusatz: „Das Beispiel der Künste“. Letzteres mit gutem Grund, denn die Kunst war – und ist – Welschs „große Liebe“, wie er seinen KulturPort.De-Lesern bereits vor gut zwei Jahren im Interview über die von ihm in die Philosophie und Kulturwissenschaft eingeführte „Transkulturalität“ verraten hat.
Gleichzeitig ist der Untertitel seiner Neuerscheinung – „Das Beispiel der Künste“ – auch ein Versprechen, und zwar auf die vielfältigen transdisziplinären Verständnis- und Verständigungsmöglichkeiten, die sich eröffnen, wenn man weitere Untersuchungsgegenstände transkulturell ausleuchten wollte. Dabei umfassen „die Künste“ im Plural bei Weitem nicht nur die bildende Kunst, obgleich letztere Welsch seit seiner Münchner und Würzburger Studienzeit bis heute besonders am Herzen liegt.
 Doch bereits ein erster flüchtiger Blick auf den beim Basler Schwabe Verlag und gleichzeitig in englischer Übersetzung (Brill, Leiden/Boston) erschienenen Band zeigt, dass der 1946 im bayerischen Steinenhausen (Kulmbach) geborene und heute als emeritierter Philosophieprofessor in Berlin lebende Autor dieses lesenswerten Sachbuchs „Wir sind schon immer transkulturell gewesen“ seine Anwendungsbeispiele keineswegs auf eine einzige Disziplin festlegt.
Doch bereits ein erster flüchtiger Blick auf den beim Basler Schwabe Verlag und gleichzeitig in englischer Übersetzung (Brill, Leiden/Boston) erschienenen Band zeigt, dass der 1946 im bayerischen Steinenhausen (Kulmbach) geborene und heute als emeritierter Philosophieprofessor in Berlin lebende Autor dieses lesenswerten Sachbuchs „Wir sind schon immer transkulturell gewesen“ seine Anwendungsbeispiele keineswegs auf eine einzige Disziplin festlegt.
Aus „der Kunst“ werden „die Künste“
Vielmehr wendet Wolfgang Welsch den von ihm in den 1990er Jahren sukzessive in die deutsch- und englischsprachigen akademischen Wissenschaftskreise eingeführten Begriff der „Transkulturalität“ (bzw. „Transculturality“) auf viele soziokulturelle Ausdrucksformen und ästhetische Gebilde in einer breiten Zusammenschau geschichtlicher Denkmuster und international renommierter Werke der Kunst und Kultur an. Doch warum sollten wir uns überhaupt mit Transkulturalität beschäftigen? Ein Grund wäre wohl, weil wir eines transkulturellen Verständnisses für eine bessere, ausdifferenziertere, gewaltlose und zugleich kritische Kommunikationsfertigkeit in einer zusammenwachsenden, globalen, immer digitaler werdenden und vor vielen Herausforderungen stehenden – und derzeit teilweise davor kapitulierenden – Welt mehr denn je bedürfen. Welsch meint, weil „die Künste“ – also auch die „Lebenskunst“ – seit Beginn der in seinem Buch grob siebentausend Jahre umfassenden Menschheitsgeschichte hybride gewesen seien und ein Wissen um diese unsere Beschaffenheit uns helfen könne, Kunst und Kultur in deren gebotener Wichtigkeit zu begreifen, wertzuschätzen und zu fördern. Unser Leben – und Überleben – kann, in anderen Worten, besser gelingen, wenn wir kollektiv internalisiert haben, dass alles mit allem verbunden ist und wir gemeinsam stärker sind: Dann werden wir sowohl für uns selbst als auch für die Weltgemeinschaft gewinnbringendere Wirkungen erzielen.
Um diese Grundthese zu untermauern, hat Wolfgang Welsch an anderer Stelle seine ebenso analog wie digital griffige „Netzmetapher“ entwickelt. Doch in „Wir sind schon immer transkulturell gewesen“ verliert er tendenziell weniger Worte über die theoretischen Hintergründe und steigt stattdessen primär materiell in die prismatische Welt des kulturellen Könnens und Kündens auf menschlicher und globaler Ebene ein. Indem er die Netzmetapher – ebenso paradigmatisch wie praktisch – konsequent anwendet, zeigt Welsch an einer Abfolge von selektiven, konkreten und dem einen Leser wohl bekannteren, dem anderen weniger bisher aufgefallenen Künstlerpersönlichkeiten, Gemälden, Skulpturen, Bauwerken und weiteren Artefakte auf, welche transkulturellen Aspekte sie vermitteln. Bevor letztere in insgesamt zehn Kapiteln mit vielen Bildern und leicht lesbaren Begleittexten komparatistisch strukturiert und ab Kapitel 1 stichwortartig sowie diachron aufbauend von den „Wurzeln Griechenlands“ (Kap. 2) bis zu unserem heutigen „Transkulturellen Alltag“ (Kap. 10) vor den Augen des Lesers aufgefächert werden, geht Welsch in seinem „Vorwort“ (S. 9-11) zunächst sowohl auf seinen persönlichen Zugang zur Transkulturalität als Denkrichtung als auch auf die letzten gut achtzig Jahre der historischen Begriffsklärung des „Transkulturellen“ kurz ein.
Dabei stellt er einführend fest, dass die Transkulturalität die Kultur per se „schon immer“ geprägt hat und somit ein Charakteristikum der Kultur bzw. der „verschiedenen Sparten der Kunst – von Malerei, Skulptur, Druckgrafik und Architektur über Literatur, Theater, Tanz, Comic, Film und Musik“ (S. 10) darstellt. Die Künste im Plural seien, so Welsch, seit jeher besonders „offen“, vorurteilsfrei und neugierig mit transkulturellen Erscheinungsformen, transformativen Kontakten und kreativen Potenzialen umgegangen. Ganz en passant revolutioniert der Philosoph dabei unseren deutschen (enggefassten) „Kunst“-Begriff und schlägt die erweiternde Mehrzahl im romanischen („Les arts“ im Französischen oder „Le arti“ im Italienischen) und englischsprachigen („the arts“) Sinn vor. Warum er „die Künste“ hier gegenüber „der Kunst“ favorisiert, leuchtet dem Leser alsbald ein: Der Grund ist transkulturell, transdisziplinär und transmedial.
Der Mischcharakter aller Kulturen
Dass jede Kultur hybride sei und immer einen „Mischcharakter“ (S. 14 f.) aufweise, macht der Autor gleich zu Beginn seiner dem 1. Kapitel vorgeschalteten „Einleitung“ (S. 13-27) deutlich. Nachdem er die Begrifflichkeiten der Multikulturalität und Interkulturalität von der Transkulturalität klärend unterschieden hat und letztere vom im angelsächsischen Raum häufig auch wissenschaftlich ins Feld geführten „Transnationalismus“ abgrenzt (S. 16 f.), stellt Welsch fest, dass „es zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Transkulturalität“ (S. 18) gibt. Die eine beziehe sich auf ein sich historisch ergebendes Kompositum unterschiedlicher „Ausgangskulturen“ (die sich durch äußere Einflüsse und innere Transformationen wie zu ständig changierenden Kaleidoskop-Bildern neu zusammenfügen), die andere auf sogenannte Universalien, d.h. die „Universalität“ (S. 197) unserer Geschichte(n) bzw. auf „eine universale Tiefenschicht [...], die allen Kulturen gemeinsam ist“ (S. 197), was Welsch in seinem 9. Kapitel („Universales als Tiefengrundlage der Transkulturalität“) näher ausführt. Beide Ausprägungen gehen gemäß Welsch damit einher, dass immer mehr Menschen konsensual Verantwortung übernehmen und sich dafür engagieren müssen, „Integrationsleistungen“ (S. 19) in tragende Eckpfeiler von Kultur zu verwandeln.
In mehreren „Blicken in die Geschichte“ (S. 19 ff.) führt Welsch einleitend zunächst Europa als Paradebeispiel eines historischen Amalgams an, um es dann unmittelbar mit dem asiatischen Kontinent in Relation zu setzen, indem er etwa der Zirkulation transkultureller Verbindungen zwischen Japan, dem antiken Griechenland, der römischen Kunst und Indien nachspürt (S. 20). Welschs gedankliche Reise durch die alle folgenden Transkulturalitätsbeispiele überspannende, ja sie umhüllende Geschichte der Menschheit setzt sich im gleichen Atemzug in Afrika, Süd- und Nordamerika fort, um „Bewegung, Hybridisierung und Verflechtung“ als „Matrix der Kulturen“ (S. 22) überzeugend auszuweisen. – Dieses einführende kulturelle Panorama einer kurzen Geschichte der weltweiten Wanderungen des Menschen zeigt einprägsam auf, dass – und inwiefern – wir es mit einer Geschichte der Hybridität zu tun haben.
Obwohl sich der Verfasser dabei – nachvollziehbarermaßen – eines eurozentrierten Ausgangspunkts nicht voll umfänglich erwehren kann, so geizt Welsch hier nicht mit (historisch hinlänglich fundierter) Selbstkritik, etwa wenn er die europäische Erfolgsformel im Zuge der Besiedlung Nordamerikas mit dem Dreiklang Erobern-Ausrotten-Versklaven ebenso nüchtern wie schonungslos verdichtet.
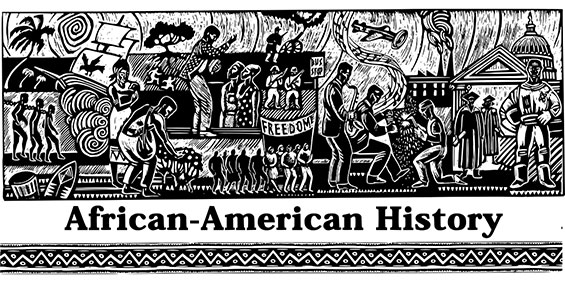
Von der Menschheitsgeschichte schließt Welsch logisch auf „Die gemischte Verfassung des Humanen“ (S. 23-25): Zum ersten Mal führt der deutsche Anthropozän-Forscher dem Leser hier, gegen Ende seiner Einleitung, nicht nur die kritischen transkulturellen Schattenseiten „von Unterdrückung und Ausbeutung“ (S. 23) im Laufe der Weltgeschichte explizit vor Augen. Vielmehr bezieht er sich an dieser Stelle auch argumentativ erstmals ausdrücklich auf „die kubanische Identität, wie Fernando Ortiz sie analysiert hat“ (S. 23), worauf er in seinem anschließenden 1. Kapitel zurückkommt. Immer wieder hebt Welsch den Gewinn einer transkulturell überformten Weltgemeinschaft hervor. Dem unterdrückerischen Machtinstinkt des Menschen stellt er unseren Freiheitsdrang entgegen. Stets gilt es auch die Möglichkeit, dass „aus Schlechtem Besseres hervorgeht“ mitzudenken und sich beiden Realitäten zu stellen: „der Verwerflichkeit von Unterdrückung und der Tatsache, dass diese nicht immer das letzte Wort hat“ (S. 23).
Jede Kultur ist eine Geschichte von Fremdanleihen
Welschs konstruktiver Ansatz spart nicht die problematischen Anteile der menschlichen „Schreckensgeschichte“ (S. 23) aus, die von sozial herausfordernden Migrationsaspekten über die klimatischen Veränderungen – einschließlich einer vom Autor prognostizierten „Klima-Migration“, ja „Klima-Kriegen“ (S. 24) – und den in der Beutekunst enthaltenen kolonialen Ambivalenzen bis hin zum schwierigen Verhältnis zwischen dem hegemonialen Drang nach Macht und dem menschlichen Wunsch nach Frieden reichen. Stets scheint – etwa am Beispiel Alexander des Großen – Welschs Idee einer Transkulturalität als kosmopolitische Gemeinschaft durch. Wie erfrischend, aber offensichtlich auch fordernd dieser philosophisch-kulturwissenschaftliche Ansatz ist, zeigt sich im letzten Teilabschnitt seiner „Einleitung“, den er dem „Vorwurf der ‚Appropriation‘“ (S. 26-27) widmet.
Warum sich Welsch hier zu einer vorauseilenden Entlastung seiner – in Wahrheit vielseitig fundierten, postmodern zeitgemäßen, ethisch richtungsweisenden und zudem, wie die weiteren Buchkapitel zeigen, höchst faszinierenden – Argumentationslinie berufen zu fühlen scheint, erklärt sich wohl aus einer direkten Erfahrung mit kritischen Infragestellungen oder Anfeindungen, mittels derer sich auch in der Wissenschaft regelmäßig Opponenten gegen fortschrittliche Konkurrenz zu wehren versuchen. Der Philosoph und Kulturkritiker Welsch greift hier dem möglichen Einwand voraus, Transkulturalität könne der Appropriation – d.h. der unrechtmäßigen, gar feindlichen Übernahme kultureller Güter, also der „Illegitimität“ oder eines „kulturellen Diebstahls“ (S. 26) – das Wort reden wollen. Angesichts seiner Ausgangsthese, der zufolge „die ganze Geschichte der Kultur [...] eine Geschichte kultureller Anleihen“ (S. 26) ist, bekräftigt der Schriftsteller und Denker Welsch hier dramaturgisch punktgenau nochmals seinen „nicht monolithisch[en], sondern gemischte[n]“ (S. 26) Kulturbegriff. Seine programmatische „Einleitung“ abrundend und sein transversales Denken „Quer durch die Künste und Kontinente“ (S. 27) geschickt betonend, bleibt mit dem Ausblick auf die nun folgende ebenso reichhaltige wie ermutigende Palette künstlerischer Werke, die Welschs Werk füllt, des Lesers Neugier und Erwartungshaltung „unserer Welt der Mischungen“ (S. 24) weiterhin optimistisch zugewandt. Im Ergebnis belebt Welsch am Übergang zum Korpus des von ihm zu Anschauungszwecken über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte hinweg angesammelten Materials sowohl in seinem „Vorwort“ als auch seiner „Einleitung“ die Disziplin der Kulturphilosophie signifikant wieder – sofern er sie mit diesem Buch nicht gar neu erfindet.
Von Fernando Ortiz über Léopold Senghor zu Simone Leigh
Im 1. Kapitel über „Das Eigene und das Andere“ (S. 29-73) entfaltet sich die ganze Stärke von Welschs transkulturellem Ansatz. Nicht nur Europa, sondern – ebenso gut und ebenso ergiebig – Kuba sind zwei mögliche Ausgangspunkte für unzählige noch ausstehende transkulturelle Analysen und Betrachtungsweisen innerhalb einer Geschichte unendlicher Breite und Tiefe sich immer fortschreibender transkultureller Vernetzungen, Erweiterungen, Überschneidungen und Überlagerungen. Es ist ganz dem Beispiel Kubas als „Paradigma“ eines transkulturellen „melting pot“ par excellence gewidmet (S. 29). Außerdem schließt Welsch hier eine wissenschaftliche Lücke: Er bezieht sich erstmals auf den Urheber des „Transkulturations“-Neologismus (1940), Fernando Ortiz. Dass der deutsche Geisteswissenschaftler, Künstler und Buchautor Welsch den kubanischen Politiker, Diplomaten, Anwalt, Ethnomusikologen und Anthropologen Fernando Ortiz gar nicht kannte, als er den Terminus der „Transkulturalität“ prägte (1992), das holt er hier gleich zu Beginn des ersten Abschnitts vom 1. Kapitel (S. 29-31) mittels der ihm umso prominenter zugedachten Stelle am Buchanfang nun nach, indem er Ortiz‘ Bedeutung und dessen „kubanische[s] Paradigma“ (S. 29) würdigt, nachdem er bereits in der „Einleitung“ (S. 23) auf diesen „Klassiker“ (S. 29) verwiesen hatte.
Nachdem Welsch im Kontext von Ortiz auf den „Kulturwandel“ der Transkulturalität als wechselseitiges „Geben und Nehmen“ und Etablierung einer „neuen Realität“ (S. 30) seit den 1920er Jahren eingegangen ist und Ortiz die „Spur der Transkulturation“ (S. 31) in der kubanischen Tradition und afrokubanischen Musik freigelegt hat, wodurch der transkulturelle Parameter mit einer bedeutsamen Afrikaaufwertung einherging, widmet sich Welsch in den übrigen acht Unterkapiteln, in die er das 1. Kapitel lesefreundlich unterteilt hat, weiteren Kulturräumen. Diese führen den Leser imaginär von Kuba zum kulturellen Schmelztiegel Brasilien und zu Oswald de Andrades „Anthropophages Manifest“ (1928) als Weg zu einem „neuen brasilianischen Selbstbewusstsein“ (S. 32). Sodann lenkt Welsch unser Augenmerk auf Léopold Senghors emanzipatorische „Négritude“-Bewegung im Dienste „einer humanistischen Weltkultur“ (S. 34), die bis heute etwa in den dezentralen, antirassistischen Protesten des Black-Lives-Matter-Netzwerks resonieren. Nachdem Welsch die „besondere Rolle [...] Afrikas zur Weltkultur“ (S. 34) herausgearbeitet hat, entführt er den Leser nach Tahiti und zu Paul Gauguins malerisch manifest gewordenen Südseeträumen, in denen der französische Künstler „das Fremde [...] nach dem eigenen Wunschbild imaginiert“ (S. 35).

Drei Vertreter der Négritude. V.l.n.r.: Léopold Sédar Senghor, Dichter, Staatspräsident des Senegal, Frankfurt/M. 1961. Quelle: Bundesarchiv B 14. Bild-F011981-0003. Lizenz: CC BY SA 3.0-de. Aimé Césaire, 2007. Quelle: Archives Territoriales Martinique. Léon-Gontran Damas, Poet und Politiker. Unbekannter Fotograf. Gemeinfrei
Während in Gauguins Kunst Eskapismus, Erotik und Exotik zu einer Triade der – egozentrischen – Transkulturalität, Imagination und Stereotypie jenseits von Politik und Gesellschaft in Bildern von einem paradiesischen „Gegen-Europa“ verschmelzen, entdeckt Welsch in Pablo Picassos Gemälde „Les Demoiselles d’Avignon“ (1907) eine progressive, durch afrikanische Masken und Plastiken inspirierte Transkulturalität. Picasso gelingt in seinen Werken eine wahre, geradezu natürlich wirkende Integration der fremden Kunst in die seinige. Im Bild des Mitbegründers des Kubismus wird die Malerei zu einer „Form der Magie“ (S. 39), zu einer Vermittlungsinstanz zwischen Identität und Alterität. Ähnliche Erfolge verzeichnet der deutsche Spurensucher der Transkulturalität im Bereich der Musik: In Antonín Dvořáks bis heute weltweit aufgeführten und geschätzten Symphonie Nr. 9 e-Moll, op. 95 „Aus der Neuen Welt“ (1893) erkennt Welsch dessen „Zuwendung zu indigenen Quellen“ (S. 41) der nordamerikanischen Musik. Der tschechische Komponist der Spätromantik findet – wie Ortiz auf Kuba – die musikalischen Wurzeln der USA u.a. in der Geschichte der aus Afrika stammenden Schwarzen und in der der Indianer, denen Dvořák „eine Stimme gegeben“ habe (S. 43). Während Dvořáks Auslegung von Transkulturalität in „der Anerkennung des Anderen“ (S. 43) bestehe, setze sich der italienische Opernkomponist Giacomo Puccini elf Jahre später in „Madama Butterfly“ (1904) ausgiebig „mit japanischer Musik“ (S. 44) integrativ auseinander. Fast zeitgleich vertont Gustav Mahler altchinesische Gedichte in seinem „Lied von der Erde“ (1908), in dem er den geistigen Inhalt der Lyrik musikalisch überschreibt, um Ost und West zu vereinen, Europa und Fernost verschmelzen zu lassen und das „Lied“ auf diese Weise zu seinem „persönlichsten Werk“ (S. 49) zu machen.
Symptomatisch klingt das 1. Kapitel von Welsch mit seiner Vorstellung der US-amerikanischen Künstlerin jamaikanischer Herkunft Simone Leigh aus, die 2022 mit dem Goldenen Löwen der 59. Kunstbiennale von Venedig u.a. für ihre „Schwarze Sphinx“ (2022) ausgezeichnet worden ist. Beispielhaft verkörpert diese Skulptur in Welschs ersten großen Bogenschlag von Ortiz bis zur Postmoderne nicht nur die Identitätssuche schwarzer Frauen, ihre „Macht und Stärke“ (S. 52) sowie die Konstruktion schwarzer weiblicher Subjektivität, sondern auch ein Cross-Over der Pyramiden von Gizeh und des Lebens im New Yorker ethnisch und sozial durchmischten Stadtviertel Brooklyn. Inbegriff eines herausragenden Beispiels „transkultureller Gestaltung“ (S. 52), materialisiert Leighs Werk in Welschs Augen den emanzipatorischen Anspruch der Transkulturalität in Form einer fast als vollkommen zu bezeichnenden Schönheit, Souveränität und Eleganz.

Simone Leigh: „Sphinx“, 2022. Hirshhorn Museum, Washington D.C. Foto: Amaury Laporte. Lizenz: CC BY 2.0
Techniken der Repräsentation von Transkulturalität
Ein ähnlich origineller Rundblick über analoge Beispiele erwartet den Leser von Welschs Ausführungen in den übrigen neun Kapiteln des Bandes. Hier schöpft der Buchautor ganz offensichtlich aus einem reich gefüllten Handwerkskasten, um uns subtil flottierende Umsetzungen und Ausleuchtungen transkultureller Parameter in den verschiedensten Kunstsparten zu präsentieren. Wie im 1. Kapitel („Das Eigene und das Andere“) wählt Welsch weiterhin jeweils einen frei angeordneten und kritisch vorselektierten Themenschwerpunkt, durch dessen Linse die Transkulturalität als innovatives Potenzial aus diversen Perspektiven konzeptuell betrachtet, bestätigt und performativ versinnbildlicht werden soll.
Ein kurzer Streifzug durch Welschs „Beispiele der Künste“ mag an dieser Stelle einen Vorgeschmack auf die eigene Lektüre vermitteln und zum genauen Nachlesen ermuntern. So führt Welsch im 2. Kapitel einige herausragende Kunstwerke und kulturelle Beiträge zum Thema „Transformationen“ (S. 53-73) an, um die „transkulturellen Wurzeln Griechenlands“ (S. 53), Europas sowie des Gespanns „China und Japan“ genauer zu untersuchen. Im 3. Kapitel hinterfragt der Publizist das spezifisch „Transkulturelle Fortleben der Antike“, indem er römische Skulpturen als Vorbilder von Albrecht Dürers Kupferstich von „Adam und Eva“ (1504) entlarvt oder die literarische Überführung von Homers „Odyssee“ in James Joyces Roman „Ulysses“ (1922) transformativ gegenliest. Die „Inspirationen“ (S. 93), die bei solchen „Re-Enactment“- und „Re-Writing“- bzw. „Re-Reading“-Techniken eine Rolle spielen, stehen im Mittelpunkt des 4. Kapitels, das mit dem Beispiel des transkulturellen Theaters von Robert Wilson und Ariane Mnouchkine ausklingt (S. 110-113). „Konstitutiv transkulturell“ steuert der Leser dann im 5. Kapitel auf literarische Verflechtungen in den Werken von Carl Zuckmayer, Johann Wolfgang v. Goethe, Henrik Ibsen oder Haruki Murakami zu, über die Welsch zum Teil bereits Einzelstudien in separat veröffentlichten Essays im Vorwege seiner Buchabfassung vorgelegt hatte.
Ums „Zusammenfinden“ geht es Welsch im 6. Kapitel: etwa architektonisch und / oder museal (wie am Beispiel der Hagia Sophia in Istanbul, der andalusischen Stadt Córdoba, der Gotik oder postmodernen Architektur) oder in der Musik (Beispiele: John Cage, Michael Jackson oder das West-Eastern Divan Orchestra), in den „Spiegelungen“ des zeitgenössischen Designs (S. 148-151) oder im Theater des taiwanischen Cloud Gate Dance Theatre. Während Welschs 7. Kapitel „Problematische Aspekte und Scheitern“ von Transkulturalität anhand von vier Gegenbeispielen kritisch in Augenschein nimmt (mit Bezugnahme auf den Kunstmarkt, Migrationsphänomene thematisierende Kunstwerke, ein rassistisches Filmbeispiel und die Benin-Bronzen), versammelt das 8. Kapitel neun Beispiele transkultureller „Transfers“. Darunter: das zeitgenössische Beispiel der afrikanischen Übersetzung, Aufführung und filmischen Adaptation von Georges Bizets Oper „Carmen“ (S. 163-165), Welschs ausführlichere Beschäftigung mit kulinarischen Darstellungen in der niederländischen Kunsthistorie sowie der weltweit vernetzten Lebensmittelgeschichte (S. 175-184) oder mit der „Mensch-Tier-Differenz“ (S.184-189). Das 9. Kapitel ist der philosophischen Bedeutung des „Universalen“ für die Tiefenstruktur von Transkulturalität gewidmet (die angeführten Beispiele stammen aus den Bereichen des Films, der Musik, des Theaters oder der Architektur) und leitet zum letzten 10. Kapitel über, das unter dem Motto „Transkultureller Alltag“ ganz im Hier und Jetzt angesiedelt ist (Beispiele: Jazz, Hip-Hop, Manga).
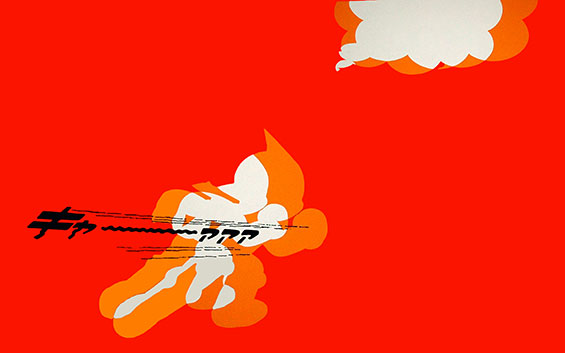
Grafik der Ausstellung: „Manga – Die Welt der Japanischen Comics“, Deichtorhallen Hamburg 2002–2003. Kuration und Foto: Claus Friede
Nachwort und Ausblick: „offener, verständnisvoller, mutiger“
In seinem „Nachwort“ (S. 225-226) resümiert Welsch sein methodisches Vorgehen und verweist zusammenfassend auf die Vorteile und Stärken, die die Transkulturalität hervorzubringen vermag. Zu ihnen zählen eine Erhöhung der „Handlungsmöglichkeiten, [...] Horizonte und [...] Lebendigkeit der Menschen“ (S. 226). Transkulturalität mache uns, so Welsch, „offener, erfahrungsreicher, verständnisvoller und auch mutiger“, kurzgesagt sei sie „das Elixier der menschlichen Existenz“ (S. 226). Ungeachtet des nationalistischen „Gegenwinds“ und bei allem Verständnis für den menschlichen „Wunsch nach Verankerung“ – welcher „Pluralität“ ja nicht ausschließe – unterstreicht der Berliner Philosoph bayrischer Herkunft abschließend die aus der Transkulturalität resultierende „Offenheit für Anderes“ (S. 226). Fazit: Ohne ein weltweites Miteinander hat die Menschheit keine Zukunft.
Insgesamt ist über Welschs spannende Reise durch „die“ Transkulturalität und ihre kulturellen Ausformungen festzuhalten, dass diese Buchlektüre eine überaus gehaltvolle, dabei flüssig geschriebene und leicht lesbare, ansprechend gestaltete sowie vom Leser persönlich zu entdeckende und erweiternde Themenauswahl enthält. Die bestechende Fülle an Illustrationsmaterial dürfte sowohl transkulturell gebildete Experten als auch solche Leser, die es werden wollen, sowie alle Freunde der Kunst und Kultur zum Überdenken, Nachmachen oder Weitergeben transkultureller Denk- und Betrachtungsweisen anspornen. Dass Ortiz‘ theoretische Einbindung erst an so fortgeschrittener Stelle von Welschs Transkulturalitätsentwurf erfolgt, gereicht dem vorliegenden Band zum Vorteil. Dieser produktionsgeschichtlich immerhin kuriose wenngleich gar nicht seltene Umstand zeigt nämlich umso deutlicher auf, wie sehr das Spannungsfeld zwischen Identität und Alterität (dem „Eigenen“ und dem „Anderen“ im Titel von Kapitel 1) nach Erscheinen von Homi K. Bhabhas Hybriditätsentwurf und Dritte-Raum-Theorie („The Location of Culture“, 1994; dt. „Die Verortung von Kultur“, 2000) bereits zuvor zur Diskussion stand und auf weitere Ausführungen wartete. Welschs fast zeitgleiche „deutsche“ Antwort auf diese Art von weltweit ausgetragenen theoretischen Aushandlungen besteht in seinem ebenso konsistent-autonomen wie innovativen und richtungsweisenden Transkulturalitätsmodell. An den Grenzen seines breit gefächerten Anwendungsspektrums der Transkulturalität bieten sich auf dem Gebiet der komparatistischen Kulturwissenschaft sowie an vielen anderen denkbaren Schalt- und Schnittstellen weiterführende Untersuchungen, Auslotungen und Fortsetzungen des regen transdisziplinären, materiellen und ideellen Austauschs im Dritten Raum an.
Das ebenso überzeugend argumentierende wie den Leser kreativ animierende, gedanklich packende und – hoffentlich – auch transformierende Buch „Wir sind schon immer transkulturell gewesen“ führt uns nicht nur in die „Welt des Wolfgang Welsch“ ein. Vielmehr zeigt es uns, wie viel der Mensch im Laufe der Kulturgeschichte bereits erschaffen hat, wie vielseitig verzahnt kulturell geprägte Formate, Personen und Werke in Wirklichkeit sind und auf welche Weise wir die Weltkultur, die vor uns liegt und an deren Konstitution wir alle längst direkt oder indirekt beteiligt sind, denkerisch ausrichten, geistig anpeilen und im besten Fall proaktiv gestalten sollten.
Wolfgang Welsch: „Wir sind schon immer transkulturell gewesen. Das Beispiel der Künste“
Schwabe Verlag, Basel, 2024
ISBN 978-3-7965-5055-3
Weitere Informationen (Verlag)
Das Buch ist auch in englischer Sprache erschienen unter dem Titel:
Wolfgang Welsch: "We Have Always Been Transcultural: The Arts as an Example"
Brill, Leiden/Boston 2024
ISBN 978-90-04-69782-9
Weitere Informationen (Verlag)
Prof. Dr. Wolfgang Welsch, geboren 1946, ist ein deutscher Philosoph, der an der FU sowie an der Humboldt-Universität zu Berlin, an den Universitäten Bamberg und Jena sowie an der Stanford University und der Emory University gelehrt hat. 1992 erhielt er den Max-Planck-Forschungspreis und 2016 den Premio Internazionale d’Estetica. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Anthropologie und Epistemologie sowie philosophische Ästhetik. Welsch veröffentlichte zahlreiche Bücher und lebt in Berlin.
Lesen Sie auch das von Dagmar Reichardt mit Wolfgang Welsch über die 59. Internationale Kunstbiennale in Venedig geführte, am 17.5.2022 erschienene KulturPort.De-Interview und mehr über Welschs Meinung zu den Arbeiten von Simone Leigh und Albrecht Dürer oder sein Verhältnis zur Kunst und Philosophie.
Wolfgang Welsch über Transdisziplinarität, den „Netzwerkcharakter aller Dinge“ und die Biennale di Venezia 2022



Kommentar verfassen
(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)
Kommentare powered by CComment