Wie kommt es, dass sich immer wieder auch gebildete und intelligente Menschen von Demagogen verführen lassen? Wie erklärt sich der Erfolg verlogener, auf den ersten Blick leicht zu durchschauender Propaganda?
In Europa, sogar in der ganzen Welt scheinen Demagogen die Macht zu übernehmen. Oder sie haben sie schon übernommen.
Wir brauchen keine Namen zu nennen, weder von Ländern noch von irgendwelchen „Führern“, um diese Behauptung zu belegen, denn ein jeder von uns hat – leider, leider – diese Namen selbst am Schnürchen. Auch in den letzten Jahrzehnten hat es Diktatoren in ausreichender Zahl gegeben, aber jetzt scheinen (scheinen, aber ist es auch gewiss?) die Leute hinter ihnen zu stehen, sie nicht allein nur zu erdulden, sondern zu unterstützen oder gar zu verehren. Gelegentlich werden diese Demagogen abgelöst, ganz selten sogar aus dem Amt gefegt, aber noch haben sehr viele großen Erfolg. Und vielleicht wird es so schnell kein Ende damit finden.
Thomas Mann ist in „Mario und der Zauberer“ der Frage nachgegangen, wie einige hierfür offenbar besonders begabte Menschen zu einem solchen Einfluss gelangen können. Und nicht etwa nur auf schwache Menschen, sondern auch auf sein namenloses Alter Ego. Seine Erzählung schildert die Veranstaltung eines Hypnotiseurs als „Soiree eines Taschenspielers“, die auch ihn als einen Skeptiker in ihren Bann schlägt. Er mag diesen Menschen nicht, er findet ihn hässlich und unsympathisch, er hält innerlich Distanz, und trotzdem… Die Erzählung beeindruckt bis heute, weil der Ich-Erzähler sich selbst nicht ausnimmt, sondern sich vielmehr über seine eigene Willfährigkeit gegenüber dem Zauberer wundert. Hatte auch er selbst seinen freien Willen verloren? Warum konnte er sich nicht dazu entschließen, zusammen mit seinen beiden kleinen Kindern den Raum zu verlassen? Warum blieb er bis zur Katastrophe?
Thema der Erzählung ist die gedrückte Atmosphäre im faschistischen Italien. Sie handelt von der Veranstaltung eines verwachsenen Hypnotiseurs, der sein Publikum gnadenlos der Lächerlichkeit preisgibt, bis ihn eines seiner Opfer erschießt. 1930 geschrieben, ist vom Nationalsozialismus noch nicht die Rede, sondern der Faschistengruß des Zauberers Cipolla ist derjenige der Italiener: „Und er streckte Arm und flache Hand aus seiner schiefen Schulter zum römischen Gruß schräg aufwärts.“ Aber um Darstellung oder Kritik einer Ideologie geht es dem Erzähler ohnehin keinen Augenblick lang, sondern sein Thema ist einzig und allein die Selbstaufgabe des Publikums unter dem – prima facie dämonischen – Einfluss eines Hypnotiseurs, dessen Macht über die Seelen er sich nicht zu erklären weiß. In dem Zauberer schien sich „das eigentümlich Bösartige der Stimmung auf verhängnisvolle und übrigens menschlich sehr eindrucksvolle Weise“ zu verdichten.
 Thomas Mann fand keine Antwort. Kann uns dagegen die antike Geschichte lehren, wie Demagogen Macht über Menschen erlangen? Der Klappentext eines Buches über römische Geschichte verspricht, „beispielhaft für alle Epochen“ zu zeigen, wie „Populismus politische Gewalt gebiert“. In einer Biographie des römischen Politikers Publius Clodius Pulcher (92–52 v.u.Z.) schildert der Althistoriker Michael Sommer den Niedergang des republikanischen Roms im Verlauf des ersten vorchristlichen Jahrhunderts. Können wir daraus, wie es der Klappentext verspricht, etwas für unsere eigene Zeit lernen? Die römische Republik, so schreibt der Autor gleich zu Beginn, „scheiterte an sich selbst – und an ihrer Unfähigkeit, die zu zähmen, auf die es in der politischen Arena ankam: die breite Masse der Bürger, vor allem aber die Elite, die in Rom ein kleiner, streng vom Rest der Gesellschaft abgeschotteter Zirkel war.“ Lässt sich dieser Vorgang in vergleichbarer Weise auch in unserer Zeit beobachten? Können wir die von Sommer erzählten Vorgänge auf uns übertragen? Helfen sie uns, unsere eigene Zeit zu verstehen?
Thomas Mann fand keine Antwort. Kann uns dagegen die antike Geschichte lehren, wie Demagogen Macht über Menschen erlangen? Der Klappentext eines Buches über römische Geschichte verspricht, „beispielhaft für alle Epochen“ zu zeigen, wie „Populismus politische Gewalt gebiert“. In einer Biographie des römischen Politikers Publius Clodius Pulcher (92–52 v.u.Z.) schildert der Althistoriker Michael Sommer den Niedergang des republikanischen Roms im Verlauf des ersten vorchristlichen Jahrhunderts. Können wir daraus, wie es der Klappentext verspricht, etwas für unsere eigene Zeit lernen? Die römische Republik, so schreibt der Autor gleich zu Beginn, „scheiterte an sich selbst – und an ihrer Unfähigkeit, die zu zähmen, auf die es in der politischen Arena ankam: die breite Masse der Bürger, vor allem aber die Elite, die in Rom ein kleiner, streng vom Rest der Gesellschaft abgeschotteter Zirkel war.“ Lässt sich dieser Vorgang in vergleichbarer Weise auch in unserer Zeit beobachten? Können wir die von Sommer erzählten Vorgänge auf uns übertragen? Helfen sie uns, unsere eigene Zeit zu verstehen?
Ich glaube nicht, obwohl Sommers Buch gut und lesenswert ist. Aber die Amoralität römischer Politik berührt uns kaum noch, weil seit unendlich langer Zeit vergangen und kaum noch anschaulich zu machen. Auch die vielen, vielen Hollywoodfilme können daran kaum etwas ändern. Und: Derselbe Typus – ich spreche von Clodius – muss heute ganz anders bewertet werden als moderne Politiker. Clodius betrachten wir aus der Distanz, ohne ihn moralisch zu verurteilen, sein modernes Pendant dagegen verabscheuen wir. Heute darf man nicht mehr wie ein alter Römer sein.
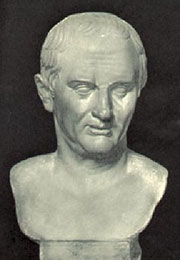 Clodius, dessen Leben Sommer erzählt, besaß in Cicero einen erlauchten Gegner, ja sogar einen erklärten Feind, und wir wissen von ihm einzig und allein dank dessen Schriften und Reden – so kann sein Bild nicht besonders freundlich oder gar schmeichelhaft sein, und wie sehr es wahrhaftig ist, wissen wir nicht. Clodius starb bei einem zufälligen Zusammentreffen mit einem politischen Gegner, der sich später Cicero als Anwalt nahm, und wieder erfahren wir über die Vorgänge nur aus der Verteidigungsschrift des „Redners“, wie Sommer Cicero meist nennt. Und von dieser Einseitigkeit, aus der Sommer natürlich kein Geheimnis macht, einmal abgesehen: Es ist überhaupt nicht klar, ob Clodius eine politische Agenda verfolgte oder allein sein eigenes Fortkommen im Auge hatte. Auch wissen wir nicht, was ihm die Masse bedeutete, ob er Anhänger besaß und ob diese überhaupt irgendeinen Einfluss auf ihn ausübten. Interessant für uns Zeitgenossen scheint diese schattenhafte Figur vor allem, weil der „Gewaltvirtuose Clodius“ ein Mann der Skandale und Affären war, ein Provokateur der unangenehmen Sorte – wenn wir Cicero trauen dürfen. Unter diesem Vorbehalt steht alles.
Clodius, dessen Leben Sommer erzählt, besaß in Cicero einen erlauchten Gegner, ja sogar einen erklärten Feind, und wir wissen von ihm einzig und allein dank dessen Schriften und Reden – so kann sein Bild nicht besonders freundlich oder gar schmeichelhaft sein, und wie sehr es wahrhaftig ist, wissen wir nicht. Clodius starb bei einem zufälligen Zusammentreffen mit einem politischen Gegner, der sich später Cicero als Anwalt nahm, und wieder erfahren wir über die Vorgänge nur aus der Verteidigungsschrift des „Redners“, wie Sommer Cicero meist nennt. Und von dieser Einseitigkeit, aus der Sommer natürlich kein Geheimnis macht, einmal abgesehen: Es ist überhaupt nicht klar, ob Clodius eine politische Agenda verfolgte oder allein sein eigenes Fortkommen im Auge hatte. Auch wissen wir nicht, was ihm die Masse bedeutete, ob er Anhänger besaß und ob diese überhaupt irgendeinen Einfluss auf ihn ausübten. Interessant für uns Zeitgenossen scheint diese schattenhafte Figur vor allem, weil der „Gewaltvirtuose Clodius“ ein Mann der Skandale und Affären war, ein Provokateur der unangenehmen Sorte – wenn wir Cicero trauen dürfen. Unter diesem Vorbehalt steht alles.
In Sommers Darstellung war Clodius‘ Handeln „immer wieder konfrontativ, rücksichtslos, erratisch und aggressiv“, er war Teil „einer auf Einfluss geradezu abonnierten Familie“, und er „besaß ein groß dimensioniertes Ego“. Ein Schelm, der bei diesen Worten an einen Herrn aus sehr reicher Familie und mit sehr schlechten Manieren denkt, der sich im Herbst um ein hohes politisches Amt bemüht… Wenn von den „Schlägerbanden [die Rede ist], die für einen charismatischen Gewaltunternehmer wie Clodius das Mittel der Wahl waren“, denken wir natürlich an denselben Herrn. Oder auch an die Straßenschlachten der Weimarer Republik. So scheint es, dass es Sommer nicht um die beispielhafte Erzählung eines Vorgangs geht, sondern um die Darstellung eines ganz bestimmten Typus, den es nicht allein in unserer Zeit, sondern auch schon früher gegeben hat. Auch wenn sich ein solcher Mensch einer Ideologie bedienen sollte, so denkt er doch einzig und allein an sich selbst, an seinen Erfolg. Er will gewinnen, alles andere ist unwichtig.

Rom, Forum Romanum, Foto: Nicole Reyes
Sommers Buch ist die Arbeit eines akademischen Autors – unaufgeregt, sehr sachlich, immer in einem sauberen Deutsch. Und natürlich ist jede Aussage gut belegt. Aber gelingt es ihm auch, uns das Bild des Clodius wirklich vor Augen zu stellen? Selbst bei Cicero bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn vor mir sehe. Wie aber sollte ich einen Politiker der zweiten Reihe – wichtig, aber doch bei weitem nicht so wichtig wie die anderen Größen – mir vorstellen können? Es fehlen ganz und gar die kleinen Charakterzüge, die das Bild eines Menschen erst lebendig werden lassen. Was motivierte sie? Hatte er ihnen Geld oder Land versprochen, oder standen sie unter dem Einfluss eines begabten Rhetors?
Ich glaube nicht, dass sich der Verfall einer Republik schildern lässt, indem man nur oben ansetzt, an der Schilderung der entscheidenden Politiker. Müsste nicht die Schar der Anhänger in den Focus rücken? Wie mussten die Römer – die auf der Straße wie die im Senat – beschaffen sein, damit sie einem Clodius hinterherliefen? Was motivierte sie? Hatte er ihnen Geld oder Land versprochen, standen sie unter dem Einfluss eines begabten Rhetors? Schließlich ist es die Mehrheit, die dem Demagogen die Macht zuschustert – ohne sie wäre er ein Nichts.
Clodius war ein durchtriebener und rücksichtsloser Intrigant, ein Machtmensch, wie es sie zu allen Zeiten gab. Ein solcher war in der Darstellung der Autorin Annika Brockschmidt auch Mitch McConnell, solange er der Fraktionsführer der Republikaner im US-Senat war. Er ist oder war (seine Karriere scheint ja beendet) sogar das, „was man gemeinhin als absoluten Machtmenschen bezeichnet.“ Will sagen: So etwas wie Überzeugungen waren ihm immer fremd, treu war er allenfalls sich selbst, und wegen seiner Rücksichtslosigkeit wurde ihm vorgeworfen, „er betreibe Politik als Blutsport“. Zunächst schien es mir sehr problematisch, die römischen Verhältnisse auf unsere Zeit zu übertragen, aber angesichts solcher Bemerkungen muss ich – vielleicht – mein Urteil revidieren. Zumindest in diesem einen Punkt scheint Clodius mit einigen heutigen Politikern vergleichbar. Nur stellt sich hier dasselbe Problem: Warum können sich solche Leute an der Spitze halten? Was ist mit seinen Anhängern? Sehen sie denn nicht, dass sie sich gegen ihre eigenen Interessen stellen?
Mich ärgert es seit Jahren, dass Politik vom äußersten rechten Rand als „konservativ“ oder „ultrakonservativ“ verharmlost wird. Wer die Uhr um Jahrzehnte, wenn nicht gar um ein ganzes Jahrhundert zurückstellen will, ist nicht konservativ; und mit Revolutionen verträgt sich eine solche Einstellung schon einmal überhaupt nicht. Konservativ zu sein, ist für den Einzelnen vollkommen legitim, und für die Gesellschaft ist es notwendig, dass konservative Gruppen existieren, damit ein Gleichgewicht herrscht zwischen denen, welche Staat, Gesellschaft und Wirtschaft modernisieren oder auch nur verändern möchten, und jenen, die das nicht wünschen, die diese Entwicklungen bremsen oder abmildern wollen. Für mich sind Konservative moderat, also gemäßigt und immer ansprechbar; aber wer von Konservativismus im Zusammenhang mit der radikalen Rechten der USA gebraucht, der verharmlost diese „Bewegungen“. „Ultrakonservativ“ ist ein Widerspruch im Beiwort.
„Radikalismus heißt Dualismus“ heißt es gleich eingangs von „Grenzen der Gemeinschaft“, dem berühmten politischen Kommentar Helmuth Plessners, der vor genau einhundert Jahren erschien. Die knappe Sentenz verdeutlicht, warum die vielbeschworene Spaltung der Gesellschaft eine notwendige, eine wirklich unausweichliche Folge jeder Radikalisierung ist. Und sie weist uns daraufhin, dass wir nicht einzelne Führerfiguren in den Mittelpunkt stellen sollen, sondern die Gesamtentwicklung im Auge behalten müssen.
Wie wir immer wieder zu hören bekommen, ist die Spaltung der Gesellschaft nirgendwo tiefer als in den USA. Die politische Korrespondentin Annika Brockschmidt hat zu diesem Thema zwei einander sehr ähnliche Bücher geschrieben. Das zuerst erschienene behandelt den derzeitigen Zustand der Republikaner und geht zwar immer wieder darauf ein, wie es zu dem dramatischen moralischen Verfall der Partei kam. Aber der Focus liegt doch eindeutig auf der Gegenwart und der Darstellung der verschiedenen Ideologien. Die Autorin hat eine erstaunliche Anzahl von Quellen durchgearbeitet, mit deren Hilfe sie die oftmals wahnwitzigen Theorien mit allen ihren bizarren Blüten schildert, und sie belegt jede ihrer Äußerungen sorgfältig und nachprüfbar. Die Anmerkungen am Ende des Buches nehmen mehr als sechzig Seiten ein, und das in einer sehr kleinen Schrift! Die Lektüre ist erschöpfend, weil es zu und zu absurd ist, was sie uns mitteilt – „QAanon“ ist nur eine besonders irrwitzige Form, aber die rassistischen und sektiererischen Theorien, die sonst noch herumgeistern, sind, wenn überhaupt, allenfalls marginal besser, also eventuell ein ganz klein wenig weniger absurd.
Gibt ihr erstes Buch zum Thema einen synchronen Überblick über die Vielfalt der Ideologien, so erzählt Brockschmidt in ihrem neuen Buch die Geschichte der angeblichen „Grand Old Party“ von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Wir erfahren eine Menge über Barry Goldwater und dessen Helfershelfer, zum Beispiel, und natürlich wird auch die jüngere und jüngste Geschichte der Partei seit den sechziger Jahren erzählt – wiederum alles sorgfältig belegt. Die Ideologie – die in Brockschmidts Darstellung nur ein Vorwand ist, die Massen hinter sich zu bringen, das gilt etwa für die aggressive Ablehnung der Abtreibung – spielt in diesem Buch eine weitaus geringere Rolle. Brockschmidt schildert eine unverstellte Machtpolitik und eine immer weiter zunehmende Aggressivität, weniger die biblisch, rassistisch oder libertär grundierten Weltanschauungen.
 In dem ersten ihrer beiden Bücher – „Amerikas Gotteskrieger“ – schreibt sie, das Motto der Anhänger der Rechten sei „Traut euren eigenen Augen nicht, traut nicht dem, was ihr hört.“ (mit Bezug auf die Fernsehbilder vom Sturm auf das Capitol). Als Lebensmotto ist (oder nur wäre?) diese Aufforderung wirklich eine Ungeheuerlichkeit. In „Die Brandstifter“ zitiert die Autorin das Interview mit einem ungenannten Mitarbeiter George W. Bushs: „Wir sind ein Imperium. Wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität.“ Sie übersetzt dieses Eingeständnis mit „Real ist das, von dem wir behaupten, dass es wahr ist“. Mit solchen Menschen lässt sich allerdings nicht mehr sprechen. Sie leben in ihrer eigenen Blase und erscheinen als nicht ansprechbar.
In dem ersten ihrer beiden Bücher – „Amerikas Gotteskrieger“ – schreibt sie, das Motto der Anhänger der Rechten sei „Traut euren eigenen Augen nicht, traut nicht dem, was ihr hört.“ (mit Bezug auf die Fernsehbilder vom Sturm auf das Capitol). Als Lebensmotto ist (oder nur wäre?) diese Aufforderung wirklich eine Ungeheuerlichkeit. In „Die Brandstifter“ zitiert die Autorin das Interview mit einem ungenannten Mitarbeiter George W. Bushs: „Wir sind ein Imperium. Wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität.“ Sie übersetzt dieses Eingeständnis mit „Real ist das, von dem wir behaupten, dass es wahr ist“. Mit solchen Menschen lässt sich allerdings nicht mehr sprechen. Sie leben in ihrer eigenen Blase und erscheinen als nicht ansprechbar.
Der Amerikaner Julian Jaynes (1920–1977) hat in seinem Buch über den „Ursprung des Bewußtseins“ eine Theorie über die Wirkungsweise der Hypnose aufgestellt. Er nennt den Geisteszustand von Hypnotisierten „paralogische Willfährigkeit“ („paralogic compliance“) und versteht darunter den Willen, alle Regeln, mit deren Hilfe sich die Wahrheit einer Aussage feststellen ließe, außer Kraft zu setzen, „damit Realitätsaussagen willfahrt werden kann, denen kein konkreter Sachverhalt entspricht.“ Die Hypnotisierten müssen von der Macht des Hypnotiseurs gehört haben und fest an diese glauben, sonst kann die Hypnose nicht gelingen. Jaynes führt den Beweis für seine Behauptung historisch, indem er die Geschichte der Hypnose besonders zu Beginn des 19. Jahrhunderts und die Rolle Franz Anton Mesmers sowie Jean-Martin Charcots vorstellt und zeigt, dass die hypnotischen Phänomene nur dort wirksam wurden, wo ihre Opfer zuvor von deren Wirksamkeit gehört hatten.

Une leçon clinique à la Salpêtrière (1887, dt.: Eine klinische Lektion in der Salpêtrière ) – eines der berühmtesten Gemälde der Medizingeschichte – stellt Charcot während einer seiner Vorlesungen über Hysterie und Hypnose dar. Neben dem berühmten Arzt und seiner Patientin „Blanche" sind auf dem Gemälde verschiedene historische Persönlichkeiten zu sehen, darunter Gilles de la Tourette (mit einer Schürze im Vordergrund).
Von hier aus also noch einmal zurück zur Erzählung Thomas Manns und seine nur zu berechtigte Verwunderung darüber, dass so viele Menschen so gern ihren Eigenwillen verleugnen. Jaynes erklärt diesen Vorgang mit der freiwilligen Verengung des Bewusstseins. „Schafft die Versuchsperson es nicht“, schreibt er, wenn er die Wirkung von Hypnose erklärt, „ihr Bewußtsein in der erforderlichen Weise zu verengen [„to narrow his consciousness“]; kann sie die Globalsituation nicht vergessen; verharrt sie in einem Bewußtseinszustand von anderweitiger Gerichtetheit […], dann schlägt die Hypnose fehl.“ Also: Der Hypnotiseur besitzt keineswegs besondere Kräfte, sondern es ist nach der Analyse dieses Psychologen die hypnotisierte Person selbst, die sich freiwillig unter die Herrschaft eines Zauberers begibt. Das scheint mir der entscheidende Punkt: Die Leute erwarten oder wünschen gar, hypnotisiert zu werden, und so geschieht es denn.
Lässt sich dieser Vorgang nicht auch auf die Wirksamkeit von Demagogie oder auf die Predigten von „Teleevangelisten“ übertragen? Jaynes kannte, als er 1976 sein Buch veröffentlichte, ja nur die ersten zaghaften Anfänge dieser Bewegungen, aber spricht trotzdem religiöse Massensuggestionen („contemporary religious litanies“) an. Vielleicht, nein ganz gewiss ist es die besondere Form der in den USA vorherrschenden Religiosität, die der kritiklosen Verehrung von Witzfiguren Vorschub leistet. Sind es also die Megakirchen, die, wie vielleicht später einmal gesagt werden wird, den Weg in die Diktatur bereiteten?
Dafür spricht unter anderem, dass der Kandidat (wir brauchen seinen Namen nicht hierher zu setzen…) seinen Wahlveranstaltungen, Brockschmidts Beobachtungen zufolge, einen „gottesdienstartigen Charakter“ verleiht, schon, weil sie mit einem Gebet eröffnet werden.
Gibt es eine moralische Pflicht, die Augen zu öffnen, die Aufmerksamkeit nicht einschlafen zu lassen und sich umzuschauen, also die „Globalsituation“ im Blick zu behalten? Ich glaube das ganz unbedingt und möchte mich auf José Ortega y Gasset berufen, der immer wieder, besonders aber in seinen „Meditationen über die Jagd“, die gespannte Aufmerksamkeit als eine Tugend des Menschen verteidigt und diese am Jäger exemplifiziert, der auf alles gefasst ist, wenn er durch den Wald schleicht, sich umschaut und in die Ferne lauscht. In seinen 1932/33 in Buenos Aires gehaltenen Vorlesungen, in deutscher Sprache im Band „Der Mensch ist ein Fremder“ nachzulesen, nennt Ortega es „ein Gebot unserer Zeit, […] sich dazu zu verpflichten, die Dinge in ihrem nackten, tatsächlichen und dramatischen Sein zu denken“. Vielleicht hätte er das Gebot nicht zeitlich einschränken sollen, denn es galt doch nicht nur für seine Jahre – es sollte schlicht als eine moralische, für alle Zeiten gültige Forderung verstanden werden.
Ortega beruft sich auf die Etymologie des Wortes „curiosidad“, das sich als Neugierde übersetzen lässt, in deren sprachlichem Ursprung er aber noch zusätzlich das Wort „cura“ entdeckt, also die „Sorge“. In dem Verb „cuidar“ (sich kümmern um, pflegen, sich sorgen), das sich davon ableiten lässt, ist sein sprachlicher Ursprung leicht zu erkennen. Ein verantwortlicher Mensch behält immer seine Umgebung im Auge und kümmert sich. Die „nach mir die Sintflut“-Einstellung des Ideologen ist ihm fremd, ja unmöglich.
Was lehren uns Jaynes und Ortega? Wenn wir diese Vorgänge verstehen wollen, sollten wir weniger die Demagogen, die Hetzer und Verführer im Auge behalten, denn das Geheimnis ihrer Wirkung liegt nicht in ihrer Persönlichkeit. Lieber sollten wir uns auf diejenigen konzentrieren, die sich verführen lassen. Wenn es stimmt, dass eine freiwillige Bewusstseinsverengung die Hypnose erst ermöglicht, dann gilt es, das Bewusstsein zu erweitern – aber natürlich nicht mit Drogen, sondern mit Aufmerksamkeit, intellektueller Anspannung und Offenheit. Wir sollten niemals glauben, ausgelernt zu haben, sondern immer bereit sein für Neues, vielleicht gar Umstürzendes. Ortega findet dieses alles in der Curiosidad versammelt, diesem Begriff, in dem wache Neugier und Sorge um die Welt einander begegnen. Wir sind dazu verpflichtet – nicht zuletzt uns selbst gegenüber –, uns umzuschauen und so vieles wie überhaupt nur möglich ins Auge zu fassen.
Die Verführung der Massen
Literatur zu dem Thema:
Michael Sommer: Volkstribun. Die Verführung der Massen und der Untergang der Römischen Republik
Klett-Cotta 2023
336 Seiten
ISBN 978-3608986440
Weitere Informationen (Verlag)
Annika Brockschmidt: Amerikas Gotteskrieger. Wie die Religiöse Rechte die Demokratie gefährdet
Rowohlt 2021
416 Seiten
ISBN 978-3499006487
Weitere Informationen (Verlag)
Annika Brockschmidt: Die Brandstifter. Wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen
Rowohlt 2024
368 Seiten
ISBN 978-3498003302
Weitere Informationen (Verlag)
José Ortega y Gasset: Der Mensch ist ein Fremder. Schriften zur Metaphysik und Lebensphilosophie.
Herausgegeben, übersetzt und mit einer Einführung versehen von Stascha Rohmer.
Alber Verlag 2008
336 Seiten
ISBN 978-3495481042
Hinweis: Die Inhalte der Kolumne geben die Meinung der jeweiligen Autoren wieder. Diese muss nicht im Einklang mit der Meinung der Redaktion stehen.


Kommentar verfassen
(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)
Kommentare powered by CComment