Woran bemisst sich die Qualität eines Kunstwerks? Darüber lässt sich auf festem Boden streiten, wenn es strenge Regeln gibt – wie für ein klassisches Drama, für ein religiöses Triptychon oder eine Sonate. Aber wie steht es um die Qualität eines Romans?
Der Roman ist unter allen literarischen Gattungen die offenste – in formaler wie in inhaltlicher Hinsicht ist so gut wie alles erlaubt, und so gut wie alles wurde auch schon versucht. Woher sollen wir da einen Maßstab nehmen?
 Gelegentlich erleben wir eine Überraschung, wenn wir nach langer Zeit wieder nach einem Buch greifen. Vor Jahrzehnten gefielen mir die expressionistischen Romane Alfred Döblins – sie gefielen mir sogar sehr –, aber als ich jetzt mich an einer Re-Lektüre seines „Wang-lun“ von 1916 versuchte, da wollte der Funke nicht wirklich überspringen. Nicht, dass ich den Roman heute schlecht fände! Nein, vieles imponiert mir noch heute, insbesondere die erstaunliche Fantasie, das erzählerische Temperament und die Kühnheiten des Stils. Dazu kommt der Mut, eine ganz und gar fremde Kultur vor meinen Augen auferstehen zu lassen, und endlich auch das Thema des gewaltlosen Widerstands. Inmitten des 1. Weltkrieges! Döblin besaß die Chuzpe, Sätze wie den folgenden hinzuwerfen, die einem gewissen Kienh-lung gelten, aber ja unter Umständen auch auf einen anderen hätten bezogen werden können: „Die unerhört schamlose Anmaßung des Kaisers, uns umzubringen, worin liegt die begründet? Er ist ein Mensch wie du, ich, die Soldaten.“ Wegen alldem lese ich immer noch, aber ohne wirkliche Begeisterung.
Gelegentlich erleben wir eine Überraschung, wenn wir nach langer Zeit wieder nach einem Buch greifen. Vor Jahrzehnten gefielen mir die expressionistischen Romane Alfred Döblins – sie gefielen mir sogar sehr –, aber als ich jetzt mich an einer Re-Lektüre seines „Wang-lun“ von 1916 versuchte, da wollte der Funke nicht wirklich überspringen. Nicht, dass ich den Roman heute schlecht fände! Nein, vieles imponiert mir noch heute, insbesondere die erstaunliche Fantasie, das erzählerische Temperament und die Kühnheiten des Stils. Dazu kommt der Mut, eine ganz und gar fremde Kultur vor meinen Augen auferstehen zu lassen, und endlich auch das Thema des gewaltlosen Widerstands. Inmitten des 1. Weltkrieges! Döblin besaß die Chuzpe, Sätze wie den folgenden hinzuwerfen, die einem gewissen Kienh-lung gelten, aber ja unter Umständen auch auf einen anderen hätten bezogen werden können: „Die unerhört schamlose Anmaßung des Kaisers, uns umzubringen, worin liegt die begründet? Er ist ein Mensch wie du, ich, die Soldaten.“ Wegen alldem lese ich immer noch, aber ohne wirkliche Begeisterung.
Ganz anders erging es mir beim „Zauberberg“. Meine letzte (damals wohl die zweite) Lektüre liegt ähnlich lange zurück, und als ich jetzt erneut nach dem 1000 Seiten-Schmöker griff, um mich auf die Lübecker Jubiläums-Ausstellung des „Jahrhundert-Romans“ einzustimmen, da hielt sich meine Vorfreude in Grenzen. Und dann – dann schlug mich der Roman vom ersten Wort an in seinen Bann. Wie konnte das geschehen? Was ist das Fesselnde dieses Buches? Ist es die Sprachkunst des Autors? Thomas Mann schrieb schließlich ein funkelnd schönes Deutsch: keinesfalls immer lange Perioden, wie gerne kolportiert wird, aber wenn, dann sind seine Sätze trotz ihrer Länge gut lesbar. Seine Sprache ist mit Witz und Ironie gewürzt, mit seltenen Fremdwörtern und überraschenden Einwürfen, nicht selten maliziös und meist anschaulich und bildhaft. Alles das macht die Lektüre zu einem schieren Vergnügen. Aber macht es bereits ein Meisterwerk aus, vielleicht gar ein Jahrhundertbuch, das mit einer Ausstellung gewürdigt werden sollte?
Da muss noch mehr sein… Und da ist auch noch mehr, sogar wesentlich mehr. Zunächst auf einer bloß handwerklichen Ebene, auf die der Autor zwar großen Wert legte, die aber nicht immer gewürdigt wird, sondern bei den Besprechungen dieses Romans viel zu oft hinter dem Stoff verschwindet. Das „Artistische“ aber war dem Autor schon in jungen Jahren wichtig, und im Laufe der Jahre erarbeitete er sich, zunächst angeregt von der Lektüre bedeutender Dichtung, aber auch unter dem Eindruck großer Musik, eine ganze Fülle von Techniken, von denen das Leitmotiv die wohl wichtigste ist. Auch der „Zauberberg“ enthält Motive, die sich in schöner Regelmäßigkeit wiederholen und so den Riesentext zusammenhalten. Einem der wichtigsten hat der Germanist André von Gronicka einen erhellenden Aufsatz gewidmet. Es ist die Formel „wir hier oben“, in der es Mann gelungen sei, „die ganze lebensfeindliche Atmosphäre der Sanatoriumswelt zusammenzudrängen“. Hans Castorp, ein junger Hamburger, besucht seinen kranken Vetter in einem Schweizer Sanatorium, und ahnt bei seiner Ankunft nicht, dass er viele Jahre „dort oben“ verbringen und auf diese Weise vielleicht sein ganzes Leben verpassen wird.
Das Handwerkliche ist also ein wesentlicher Punkt, aber wie schon der Stil bietet es nicht mehr als das solide Fundament, auf dem sich ein großes Kunstwerk errichten lässt. Ein anderer, in der Kritik vielleicht zu sehr betonter Aspekt ist die Wende des Autors zur Demokratie. Mit seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“, erschienen 1920 und damit nur vier Jahre vor dem „Zauberberg“, stellte er sich in die Reihe der Antidemokraten, mit dem großen Roman aber, so wird er heute oft gelesen, korrigierte er bald darauf seine Positionierung. Nähern wir uns also dem Kern des Romans, wenn wir uns auf die zeitgeschichtlichen Bezüge konzentrieren und ihn quasi politisch lesen?

Waldsanatorium in Davos Platz. Die Innenraume sind im Roman nach dem Waldsanatorium gestaltet, in dem auch Katia Mann 1912 untergebracht wurde. Archiv Günther Schwarberg, Hamburg, Fotograf:in: Unbekannt
Dem Schicksal Hans Castorps, das schreibt der Autor selbst in einem der ersten Kapitel, kommt eine „gewisse überpersönliche Bedeutung“ zu, denn sein Leben sei von „seiner Epoche und Zeitgenossenschaft“ geprägt. Am Ende des Buches heißt es, „ein bedeutender Gegenstand“ sei „eben dadurch ‘bedeutend‘, daß er über sich hinausweist, daß er Ausdruck und Exponent eines Geistig-Allgemeineren ist, einer ganzen Gefühls- und Gesinnungswelt, welche in ihm ihr mehr oder weniger vollkommenes Sinnbild gefunden hat“. Für Hans Castorp interessieren wir uns nur ganz beiläufig wegen ihm selbst, sondern vor allem wegen der symbolischen Bedeutung, die seinen Jahren „dort oben“ zukommt, und es ist wohl diese Perspektive, aus der die Kritik immer wieder auf den „Zauberberg“ schaut. Und keinesfalls zu Unrecht, denn schließlich kann sie sich auch auf den Autor berufen, der im Vorwort (einem 1939 in Princeton gehaltenen Vortrag) von seinen Figuren sagt, sie seien „lauter Exponenten, Repräsentanten und Sendboten geistiger Bezirke, Prinzipien und Welten.“
Aber widerfährt dem Roman Gerechtigkeit, wenn wir ihn auf ein zeitgeschichtliches Dokument reduzieren? Sicherlich nicht, obwohl besonders die ausführliche Darstellung des Zwists von Naphta, dem Jesuiten von „ätzender Häßlichkeit“, und Settembrini, dem „Drehorgelmann“, uns in die Zeit vor dem 1. Weltkrieg hineinführt, in ihre geistigen Spannungen und Konflikte. Diese mit scheinbar leichter Hand dargestellten Dispute zwischen dem Gläubigen und dem Aufklärer, dem Gottesmann und dem Humanisten sorgen für eine große intellektuelle Tiefe und für eine Spannung von grundsätzlicher Bedeutung, die schließlich mit einem Knall – dem Suizid Naphtas, bald darauf die Einberufung Castorps – gelöst wird. Aber spiegeln diese Dispute tatsächlich die intellektuelle Atmosphäre und die großen Themen der Vorkriegszeit? Und inwiefern verstehen wir den Roman besser, wenn wir die Vorbilder Naphtas und Settembrinis kennenlernen?
Niemals und an keiner Stelle werden die Protagonisten – diese wie auch andere – zu Abziehbildern einer bestimmten Position. Der „Zauberberg“ ist alles, aber ganz gewiss kein Thesenroman. Seine Figuren sind wirkliche, lebendige und blutvolle Menschen, die wir in ihrer ganzen Tiefe und Widersprüchlichkeit erfahren – auch deshalb, weil der Autor sie einmal gesehen hat und sie ihm noch vor Augen standen, als er an seinem Roman schrieb. So ist es zunächst die Schilderung der Figuren, die den Roman so außerordentlich macht und ihn in unser Gedächtnis brennt. Niemand, der den „Zauberberg“ gelesen hat, wird seine Protagonisten vergessen – selbst nach Jahrzehnten nicht. Ich weiß das! Von Döblins Roman dagegen hatte ich nicht mehr als die Hauptfigur vor Augen – wenn überhaupt –, und auch die erneute Lektüre macht mir nur wenige der zahllosen Gestalten lebendig, wogegen sich alle wichtigen Figuren des „Zauberbergs“ den Lesern unauslöschlich einprägen. Es sind ja nicht allein Naphta und Settembrini, sondern noch etliche andere, so Mynheer Peeperkorn und ganz besonders Madame Chauchat.
„Haben Sie sie schon manchmal gehen sehen?“, fragt Hofrat Behrens: „Wie sie geht, so ist ihr Gesicht. Eine Schleicherin.“ Es ist ja wahr: Wer den Namen Clawdia Chauchat hört, der denkt an die klirrende Tür, die ihren Eintritt in den Speisesaal begleitet (ein Leitmotiv…), und noch mehr an ihren typischen Gang. Sie „ging eigentümlich schleichend und etwas vorgeschobenen Kopfes“. Am Ende des Buches – diese Figur stand dem Autor wirklich vor Augen! – heißt es von ihr, sie habe sich „mit vertrautem Katzentritt, vorgeschobenen Kopfes“, dem Tisch genähert. „Wie schlecht sie sich hielt!“, heißt es an anderer Stelle, und das ist ja nun mehr als überraschend, denn die Schönheit einer Frau wird nicht zuletzt mit ihrer guten, das heißt mit ihrer aufrechten, gelegentlich königlichen Haltung in Verbindung gebracht. Aber nicht in diesem Fall. Wie passen ihre Schönheit und der schleichende Gang zusammen?
Die Körperhaltung wie auch die Gangart charakterisieren einen Menschen, weil sie mehr oder weniger direkt, mehr oder weniger komplett seine innere Verfassung widerspiegeln. Deshalb kann Thomas Mann fast alle wichtigen Figuren dieses Romans mittels ihres typischen Ganges charakterisieren. Eben diese Technik findet sich bereits in seinen ersten Erzählungen. In „Der kleine Herr Friedemann“ (1897) wandert dieser „mit der komisch wichtigen Gangart, die Verwachsenen manchmal eigen ist“, eine Straße entlang. Von „Tobias Mindernickel“ (1898) sagt der Erzähler, er laufe „mit hochgezogenen Schultern und vorgestrecktem Kopfe davon, wie ein Mensch, der ohne Schirm durch einen Platzregen eilt“. Aber als er mit sich selbst zufrieden sein darf, schreitet er „fest und aufrecht“. Die Eigenart, Figuren mittels einer präzisen Beschreibung ihres Ganges darzustellen, durchzieht das Gesamtwerk dieses Erzählers von Anfang an.
Im „Zauberberg“ heißt es von Hans Castorp, dass er im „Gehen und Stehen […] den Unterleib etwas“ vorschob. So „stramm“ wie sein Vetter Ziemßen („der junge Ziemßen in militärischer Haltung“), der so gerne Offizier werden möchte, hält er sich jedenfalls nicht. Aber noch viel anschaulicher als Castorp selbst wird Hofrat Behrens geschildert – eine jener Figuren, die dank ihrer lebhaften Beschreibung kaum jemand nach der Lektüre vergessen kann. Nach einem seiner ersten Auftritte heißt es, dass er „weitersegelte, mit den Armen schlenkernd, die Handflächen ganz nach hinten gekehrt“. Ein Autor, der eine Figur so plastisch schildert, hat sicherlich viel Zeit in seinem Leben damit verbracht, die Gangweise seiner Mitmenschen zu studieren.
Ein weiterer Aspekt ist die sehr individuelle Sprache eigentlich aller Figuren, die aber besonders den ärztlichen Leiter des Sanatoriums, Hofrat Behrens, auszeichnet. Von Naphtas Stimme heißt es, sie erinnere „beim Sprechen an den Klang eines gesprungenen Tellers“. Aber an niemanden erinnern wir uns lebhafter als an Peeperkorn. Ein „eigentümlicher, persönlich gewichtiger, wenn auch undeutlicher Mann.“ Aber warum denken wir an ihn? Eben deshalb: wegen seiner Undeutlichkeit! Weil die Rede des schwerreichen holländischen Pflanzers sich in ausdrucksvollen, ganz und gar sinnfreien Gesten erschöpft. Naphta und Settembrini, beide grundgelehrt und der alten Sprachen kundig, disputieren und schleudern einander Argumente entgegen, Peeperkorn dagegen nimmt Anlauf, als wollte er nun gleich große Einsichten verkünden, alle in seiner Umgebung fiebern seinem Wort entgegen – und dann kommt nichts. Gar nichts! Nachdem er eine Äußerung mit „Aufmerksamkeit spannenden Gebärden, den delikat-nuancierenden, gepflegten, genauen und reinlichen Kulturgebärden eines Dirigenten“ eingeleitet hat, enttäuscht er seine Hörer regelmäßig mit einem „dem Inhalte nach nicht recht greifbaren Sprechen“. Wie kommt es, dass mir eine solche Figur über Jahrzehnte vor Augen stand, als wäre ich ihr wirklich begegnet? Sie ist ebenso plastisch wie Madame Chauchat.
In diesem Zusammenhang muss ich auch als Bewunderer des Autors zugeben, dass Thomas Mann in allen seinen Büchern viel besser Männer beschreibt als Frauen, deren Schilderung gelegentlich sogar in die Karikatur abgleitet – Madame Chauchat ist eine erfreuliche Ausnahme. Frau Stöhr dagegen, nur zu gern wegen ihres fehlerhaften Fremdwortgebrauchs zitiert – von ihr heißt es, sie nenne Peeperkorn einen „Geld-Magneten (Magnat! Die Fürchterliche!“ (785) Das ist ein eines großen Autors unwürdiges Gewitzel! –, Frau Stöhr also ist das Abziehbild eines lebendigen Menschen, und das gilt auch noch für die geradezu gehässig geschilderte Adriatica von Mylendonk und andere weibliche Gestalten.
Den „Zauberberg“ durchziehen weniger Handlungsstränge als vielmehr verschiedene Themen, die von größter existentieller Bedeutung für ausnahmslos jeden Menschen sind. Sie finden sich zu einem kunstvollen Geflecht, zu einem gewaltigen erzählerischen Teppich verwoben, in dem sich nicht weniger dargestellt sieht als unser aller Schicksal. Zwei dieser Themen – nur zwei, aber doch wohl die wichtigsten – seien herausgegriffen. Zunächst und vor allem sind es Krankheit und Tod. Und schließlich ist da die Frage nach der Zeit, die in jenen Jahren noch andere Autoren umtrieb – „Sein und Zeit“, nur wenig später erschienen, ist der bekannteste Versuch, sich dem Verhältnis von Zeit und persönlicher Existenz zu nähern.
Unzählige Gespräche kreisen um die Frage, was Krankheit und Tod für den Menschen bedeuten. Erst kürzlich hat mir ein Leser dieses Romans verraten, dass ihn die Lektüre wegen der Allgegenwart von Krankheit „heruntergezogen“ habe. Aber geht es in diesen Gesprächen wirklich nur um das Bittere, dass uns Menschen Krankheit und Tod – nein, nicht irgendwie bedrohen, sondern dass sie zu unserer Existenz gehören? Madame Chauchat registriert eine „Steigerung und Betonung ihres Körpers durch die Krankheit“, und ebenso ergeht es Hans Castorp selbst, als er eben erst dort oben angekommen ist und sich vom Glühen seines Gesichts belästigt fühlt. Er spürt seine Wangen, und so ist die Gesichtsröte eine Begegnung mit seinem leiblichen Selbst. Ihm als Patienten wird das tägliche Fiebermessen zu einer ganz systematischen, sehr regelmäßigen Selbstzuwendung. Ist die durch Krankheit und Kurdienst forcierte Eigenwahrnehmung, die Kenntnisnahme und das Wichtignehmen seiner physischen Zustände, ein wesentlicher Aspekt der Kultur, vielleicht gar so etwas wie ihre Initialzündung? Und (falls wir diese Frage bejahen sollten): Wie kann deshalb ein Mensch krank und dumm zugleich sein, wie kann er „unverfeinert durch Krankheit und Leiden“ bleiben? Das versteht Hans Castorp nicht, wenn er sich beim Mittagessen unter Frau Stöhrs Kommentaren windet.
Im „Zauberberg“ also scheint die Krankheit eine Quelle der Kultur, weil wir dank ihrer uns selbst mit gesteigerter Intensität wahrnehmen. Anders als das Tier schaut der Mensch auf sich zurück. „Nur unsere Augen“, heißt es in den „Duineser Elegien“, „sind wie umgekehrt“. Castorp fragt seinen Onkel James, ob er „nie gemerkt habe, daß der Ausbruch einer Krankheit etwas Festliches habe, eine Art Körperlustbarkeit darstelle.“ Hätte Settembrini das vernommen, Castorp wäre scharf getadelt worden. Aber der Erzähler nimmt dieselbe Perspektive ein, denn er beschreibt die Patienten als „leicht fiebernd sämtlich, zugleich betäubt und erregt vom Gehen und Reden im Höhenfrost, zum Zittern geneigt ohne Ausnahme“. Die Krankheit vergrößert ihre Sensitivität – sie leben, obwohl abgeschieden und passiv, intensiver, eben „zugleich betäubt und erregt“.
Dazu erfährt der Mensch in der Krankheit seine Sterblichkeit. Hier greift Thomas Mann auf ein geradezu barockes Motiv zurück, das uns an Sinnbilder des 17. Jahrhunderts erinnert. Als Hans Castorp auf seine eigene Hand im Röntgenbild schaut, glaubt er, „in sein eigenes Grab“ zu blicken. „Das spätere Geschäft der Verwesung sah er vorweggenommen durch die Kraft des Lichtes, das Fleisch, worin er wandelte, zersetzt, vertilgt, zu nichtigem Nebel gelöst, und darin das kleinlich gedrechselte Skelett seiner rechten Hand“. Zum „erstenmal in seinem Leben verstand er, daß er sterben werde.“. In diesem Punkt erinnert der Roman tatsächlich an „Sein und Zeit“, das vier Jahre später erscheinen wird und in dem es der Vorausblick auf den gewissen Tod ist, der dem Menschenleben Tiefe und Würde verleiht – falls er vor diesem Blick nicht in die „Uneigentlichkeit“ ausweicht. Diesen Vorwurf können wir Hans Castorp wohl nicht machen.
Später – viel später, nachdem er oft und viel über Krankheit nachgedacht hat – später sagt Castorp: „so viel sei gewiß, daß Krankheit eine Überbetonung des Körperlichen bedeute, den Menschen gleichsam ganz und gar auf seinen Körper zurückweise und so der Würde des Menschen bis zur Vernichtung abträglich sei, indem sie ihn nämlich zum bloßen Körper herabwürdige. Krankheit sei also unmenschlich.“ Das sagt er im Sinne Settembrinis, und so folgt Naphtas Widerspruch auf dem Fuße: „Krankheit sei höchst menschlich, setzte Naphta sofort dagegen; denn Mensch sein heißt krank sein. Allerdings, der Mensch sei wesentlich krank, sein Kranksein eben mache ihn zum Menschen“. (658) „Der Geist sei es, was den Menschen, dies von der Natur in hohem Grade gelöste, in hohem Maße sich ihr entgegengesetzt fühlende Wesen, vor allem übrigen organischen Leben auszeichne. Im Geist also, in der Krankheit beruhe die Würde des Menschen und seine Vornehmheit.“ Der Mensch sei „das Sorgenkind des Lebens“. Könnte es sein, dass Naphta hier die Position Thomas Manns ausspricht und mit ihr die schlichte Wahrheit?
Und nun die Zeit – und mit ihr der Tod. Wie wir gleich zu Beginn des „Zauberbergs“ und dann, wenn wir das immer noch nicht begriffen haben sollten, expressis verbis im siebten und letzten Kapitel erfahren, ist sie das eigentliche Thema des Romans; und das, obwohl man sie nicht erzählen könne, denn schließlich sei sie kein „Element der Erzählung“. „Tatsächlich“, gibt der Autor zu, „haben wir die Frage, ob man die Zeit erzählen könne, nur aufgeworfen, um zu gestehen, daß wir mit laufender Geschichte wirklich dergleichen vorhaben.“ Ein kühnes Vorhaben! Und natürlich muss es dann ein gewaltig dickes Buch werden, eines, an dem man lange, sogar sehr lange liest – nicht allein Hans Castorp muss das Vergehen der Zeit erleiden, dem Leser muss eben dasselbe widerfahren. Lesend müssen wir den unerbittlichen Ablauf der Zeit in der Lektüre erleben. In einem kurzen Gedicht lässt sich ein mystischer Augenblick einfangen, wie es Gottfried Benn gelungen ist – „Ein Glanz, ein Flug, ein Feuer“ –, aber für das Vergehen der Zeit müssen wir uns ein wenig mehr Zeit gönnen. Oder widerspricht dem das berühmte Schneekapitel, in dem Castorp jede, nicht allein die räumliche Orientierung verliert?
Seit Eberhard Lämmerts „Bauformen des Erzählens“, aus guten Gründen für lange Jahre ein Standardwerk für Germanistikstudenten, unterscheiden Literarhistoriker zwischen „Erzählzeit“ und „erzählter Zeit“, also eigentlich – so ließe sich das ausdrücken – zwischen Lesezeit und der Dauer einer Epoche oder eines Vorgangs, die dem Leser vor Augen gestellt werden. Das Verhältnis zwischen beiden sagt viel über das Temperament eines Erzählers und sein Werk aus. Döblins „Wang-lun“ ist in manchen Passagen wie ein historisches Buch und erzählt sehr gerafft in wenigen Zeilen ein Geschehen, das Wochen oder Monate in Anspruch genommen hat; und dann wieder zieht sich ein Gespräch über viele, viele Seiten hin.
Und Thomas Mann? Er behandelt dieses Verhältnis virtuos und wechselt von einem Tempo in ein anderes. Seine vollendete Meisterschaft demonstriert er in den Passagen, in denen kurz nach der Ankunft seines Helden in Davos die kurzen Monate geschildert werden, die der noch sehr kindliche Hans Castorp nach dem Tod seiner Eltern bei dem Großvater verbringt – ihr gemeinsames Betrachten der Gegenstände eines Kabinetts provoziert bei dem Kind „wortlose und also unkritische, vielmehr nur lebensvolle Wahrnehmungen“.
Besonders für das Schneekapitel gilt, dass der Autor seinem im Vorwort verkündeten Vorhaben, „die Aufhebung der Zeit“ zu schildern, „jedem Augenblick volle Präsenz zu verleihen und ein magisches ‚nunc stans‘ herzustellen“, beängstigend nahe kam. Das Ziel des Kuraufenthaltes, aber vielleicht auch dieses Erzählens, ist nicht zuletzt eine weiter gesteigerte Selbstwahrnehmung. Und so kommt Castorp ausgerechnet in einer Situation, in der es ihm um sein nacktes Leben zu gehen scheint – im tobenden Schneesturm –, auf und in sich selbst zurück. Er begegnet der Stille, „wenn er regungslos stehenblieb, um sich selbst nicht zu hören“. So nimmt er von seiner Umgebung weniger und weniger, zuletzt gar überhaupt nichts mehr wahr: Es ist „das Urschweigen, das Hans Castorp“ belauscht und das ihn in „eine beständige fromme Erschütterung und scheue Erregung“ führt. Ihn ergreift „ein heimlich-heiliger Schrecken“.
Wessen Zeit vergeht also? Diejenige von Hans Castorp. Ist es eigentlich sicher, dass er nicht an die Küste und damit in ein wirkliches Leben zurückkehren darf? Die anderen Hausbewohner sind wirklich krank, er aber ist doch bestenfalls ein wenig kränklich oder schwach, und besonders Settembrini weiß und hält es ihm vor, wie fragwürdig sein langes Verbleiben „dort oben“ ist. Der Italiener erklärt seinen jungen Freund für gesund und fragt ihn unverblümt, wie es denn wäre, wenn „Sie darauf verzichteten, hier älter zu werden“? Wie recht Settembrini mit seiner Warnung hat, könnte auch Castorp selbst wissen, denn hat er sich nicht gleich an seinem ersten Abend zum Schlafen in „ein gewöhnliches Totenbett“ gelegt? Er tat es, um in der Folge sein eigentliches Leben zu versäumen.
Wegen alldem ist das gewaltige Buch viel mehr als nur Darstellung und zeitkritische Deutung einer Epoche, sei es die Thomas Manns, sei es die Castorps. Es ist ein Roman über uns selbst, und einige der Fragen, die es uns stellt – in einer sehr dringlichen Form –, richtet es an uns Leser. Woran sich also die Qualität eines Kunstwerks ablesen lässt? An seiner Bedeutung für unser eigenes Leben. Woher den Maßstab nehmen? Aus uns. Ließe sich von diesem Roman das sagen, was Rilke über einen antiken Torso geschrieben hat: „denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht“? Auf Kunstausstellungen oder nach der Lektüre eines beliebigen Buches wird gerne gefragt, was es mit einem „gemacht habe“. In aller Regel ist diese Frage nicht ernst gemeint, und niemand erwartet eine Antwort. Nach Rilke aber sagt ein großes Kunstwerk einfach: „Du mußt dein Leben ändern.“
100 Jahre „Der Zauberberg“
Am 13. September 2024 eröffnen anlässlich des 100. Jubiläums dieses Buchs gleich zwei Ausstellungen in Lübeck:
Das Buddenbrookhaus würdigt das Thema mit der kulturgeschichtlichen Ausstellung „Thomas Manns Der Zauberberg. Fiebertraum und Höhenrausch“ in den Räumen des St. Annen-Museums.
Parallel eröffnet in der benachbarten Kunsthalle St. Annen die Kunstinstallation „Extra Time“ der zeitgenössischen britischen Künstlerin Heather Phillipson.
In der mittelalterlichen Sammlung des St. Annen-Museums finden sich zudem an sieben Stationen „Zauberberg-Interventionen“.
Weitere Informationen (Lübecker Museen)
Es gibt eine Reihe verschiedener Ausgaben auf dem Buchmarkt. In diesem Artikel wird der Roman nach der Stockholmer Ausgabe zitiert: Thomas Mann: Der Zauberberg. Roman, Stockholm 1954
Alfred Döblin: Die drei Sprünge des Wang-lun. Roman.
504 Seiten, S. Fischer

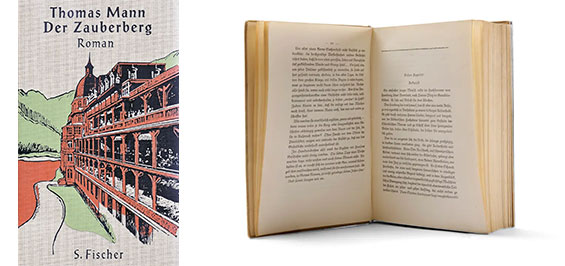

Kommentar verfassen
(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)
Kommentare powered by CComment