Der vierte Band der „Philosophie der symbolischen Formen“ Ernst Cassirers ist in der Philosophischen Bibliothek erschienen.
Die zwanziger Jahre waren eine der produktivsten Epochen der deutschen Philosophie, denn selten zuvor und ganz gewiss niemals danach erschienen in so kurzer Zeit so viele bedeutende Werke. Eines der wichtigsten war die dreibändige „Philosophie der symbolischen Formen“ (1923–1929) des damals an der neugegründeten Universität Hamburg lehrenden Ernst Cassirer, ein Werk, das schon bald den Rang eines Klassikers erlangte und bis heute ein sorgfältiges Studium verdient. Am Ende seiner Vorrede zum dritten und letzten Band kündigt der Autor ein Buch an, das die „Beziehung und Verknüpfung“ seiner Überlegungen und Ergebnisse „mit der Gesamtarbeit der wissenschaftlichen Philosophie“ darstellen sollte, denn es sei ihm „niemals förderlich und fruchtbar erschienen“, eine Arbeit „sozusagen in den leeren Raum hineinzustellen“.
Leider ist dieser vierte Band niemals erschienen. Der Herausgeber John Michael Krois erklärt im Vorwort, warum Cassirer ihn nicht mehr vorlegen konnte – die Gründe waren größtenteils biographischer Natur, von denen die Emigration 1933 der wichtigste war. Später, in seinem „Essay on Man“ (1944, auf Deutsch: „Versuch über den Menschen“), sollte Cassirer ein ähnliches Buch schreiben. Seinem ursprünglichen Vorhaben allerdings war es leider nicht mehr als nur ähnlich, und weil er es auf Englisch schreiben musste, kann es nicht an das sprachliche Niveau seiner früheren Werke heranreichen. Immerhin fanden sich in seinem Nachlass umfangreiche Notizen und Vorarbeiten – die ersten gut einhundert Seiten dieses Buches sind ein ausgearbeiteter Text –, aus denen 1995 der erste Band seines Nachlasses ediert werden konnte. Das vorliegende Buch ist der text- und seitenidentische Nachdruck dieser auch hohen Ansprüchen genügenden Edition. Sie bietet nicht allein den Text des Nachlasses, sondern auch einen Anhang mit einer Literaturliste und vor allem mehr als sechshundert nützlichen Erläuterungen in Endnoten.
Cassirer, Meisterschüler der beiden Marburger Philosophen Hermann Cohen und Paul Natorp, schrieb zu Beginn seiner Universitätslaufbahn herausragende Arbeiten über Descartes und Leibniz und verfasste ein vierbändiges Werk über das „Erkenntnisproblem in der Philosophie“, für das er bereits nach dem zweiten Band einen sehr renommierten Preis erhielt. Während der ersten Hälfte seiner Laufbahn galt er als Philosophiehistoriker und dazu Erkenntnistheoretiker. 1910 legte er mit „Substanzbegriff und Funktionsbegriff“ ein erstes eigenständiges Werk vor, in dem er zeigte, wie mit der Hilfe der Mathematik die Gegenstände der Erkenntnis zu einem Gewebe verknüpft und in einen „Verflechtungszusammenhang“ verwandelt werden. Mit dieser Arbeit setzte er die Tradition der Marburger Schule fort, deren sehr strenges Denken von Logik und Mathematik, insbesondere der Infinitesimalrechnung, bestimmt war.
 Aber spätestens mit dem ersten Band seiner „Philosophie der symbolischen Formen“, das der Sprache gewidmet ist, löste sich Cassirer von dieser Tradition. Er begründete die Kulturphilosophie, in der er den Menschen nicht mehr nur als „animal rationale“ beschrieb, sondern darüber hinaus als „animal symbolicum“ verstand, wie er in seinem „Versuch über den Menschen“ schreiben sollte. Hans Blumenberg nannte die „Philosophie der symbolischen Formen“ einen „Ausstiegsversuch aus dem Neukantianismus“, aber tatsächlich war sie viel mehr als das: Sie war dessen Fortsetzung und Überwindung zugleich.
Aber spätestens mit dem ersten Band seiner „Philosophie der symbolischen Formen“, das der Sprache gewidmet ist, löste sich Cassirer von dieser Tradition. Er begründete die Kulturphilosophie, in der er den Menschen nicht mehr nur als „animal rationale“ beschrieb, sondern darüber hinaus als „animal symbolicum“ verstand, wie er in seinem „Versuch über den Menschen“ schreiben sollte. Hans Blumenberg nannte die „Philosophie der symbolischen Formen“ einen „Ausstiegsversuch aus dem Neukantianismus“, aber tatsächlich war sie viel mehr als das: Sie war dessen Fortsetzung und Überwindung zugleich.
In diesem Buch, in „Zur Metaphysik der symbolischen Formen“, schreibt er gleich eingangs, es gehe in seiner Philosophie um „jene Dynamik der Sinngebung, in der und durch welche die Bildung und Abgrenzung bestimmter Seins- und Bedeutungssphaeren sich vollzieht.“ Es geht also um die Einheit des Wissens und der Erkenntnis, und dabei fällt zunächst auf, dass er nicht vom Sein ausgeht, sondern vom erkennenden Subjekt und so auch in diesem Buch eine gemäßigte idealistische Position vertritt. Die Wortwahl – „Bildung und Abgrenzung“ – deutet an, dass es sich um die denkerische Bewältigung des Gegensatzes von Kontinuität und Diskretion handelt, um das Beschreiben, Erkennen und Verstehen einzelner Bereiche des Seins durch Sprache, Mythos und Wissenschaft, also nicht mehr vorwiegend oder gar allein durch die Mathematik.
Es sei, hieß es bereits im ersten Band von 1923, „das Grundprinzip der Erkenntnis […], daß sich das Allgemeine immer nur im Besonderen anschauen, das Besondere immer nur im Hinblick auf das Allgemeine denken läßt“, und eben dies leiste die Sprache. Syntax, Grammatik und andere formale Elemente bilden das Kategoriensystem, mit dem wir uns das Sein zugänglich machen. Cassirer wendet sich gegen pragmatistische Positionen, wenn er schreibt, dass es nicht um den „Willen zur Macht“ gehe, sondern dass für ihn der Geist der „Wille zur Gestaltung“ ist. Sein Interesse gilt der Genese unserer Welt, ihrer Formung durch die „Medien“ Sprache, Mythos und Wissenschaft, und dafür hat er sich nicht allein mit den europäischen Sprachen beschäftigt, sondern auch auf Untersuchungen indigener Sprachen zurückgegriffen.
Gelegentlich wird vorgeschlagen, von einem „linguistic turn“ Cassirers zu sprechen und damit sein ungeheuer ambitioniertes Vorhaben mit der Reduktion der Philosophie auf die Analyse der Sprache gleichzusetzen. Aber das ist mindestens übertrieben, wenn nicht sogar verkehrt, denn für Cassirer ist die Sprache nur ein Bereich des Seins, den er erforschen möchte. Gleich der zweite Band, in dem er sich als erster bedeutender Philosoph seit Schelling dem Mythos zuwendet – Blumenberg spricht davon, dass Cassirers Forschungen ihn „zum exotischen, zum obskuren Material“ geführt haben –, zeigt die bewundernswerte Vielfalt seiner Interessen ebenso wie die Fähigkeit dieses Philosophen, sich tief in die verschiedensten, ihm ursprünglich ganz fremden Wissenschaften einzuarbeiten und dort eigene Akzente zu setzen. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass sein eigentliches Arbeitsgebiet die Interpretation philosophischer Klassiker und die Kommentierung der mathematischen Grundlagenforschung gewesen ist. Die damals in Hamburg beheimatete Bibliothek Warburg stellte ihm das Material zur Verfügung, das er brauchte, und dazu waren bedeutende Kunsthistoriker wie Edgar Wind, Aby Warburg oder Erwin Panofsky ideale Gesprächspartner.
 In dem jetzt erstmals als wohlfeile Studienausgabe veröffentlichten Buch nehmen Cassirers Überlegungen ihren Ausgang von dem Gegensatz von „Leben und Form“, der ihm gleichbedeutend scheint mit dem von fließender „Kontinuität und Individualität“. Er greift dafür die einleitenden Bemerkungen Georg Simmels aus dessen letztem Werk „Lebensanschauung“ auf, in denen dieser das Sich-selbst-Überschreiten des Menschen, die Überwindung seiner Grenzen und damit das Transzendieren seiner Welt thematisiert. Mit der Lebensphilosophie setzt sich Cassirer auch im Folgenden kritisch auseinander – Simmels Gedanken stand er zwar nicht vorbehaltlos zustimmend gegenüber, aber ihn und noch dazu Henri Bergson und Ludwig Klages, zu denen er viel mehr Abstand besaß, stellt er zwar nicht unkritisch, wohl aber ohne jede Polemik vor. Besonders Klages, dessen Werk ja durchaus fragwürdige Seiten besitzt, nähert er sich voller Verständnis und mit Verweisen auf dessen Verdienste, um erst zum Schluss seine Kritik zu formulieren. Nicht zuletzt dieser Fähigkeit zu einer immer sachlichen Kenntnisnahme anderer Positionen verdankt sein Werk seinen enormen Reichtum an Gedanken und Ideen. Es gibt nicht viele philosophische Werke, deren Lektüre ähnlich anregend ist.
In dem jetzt erstmals als wohlfeile Studienausgabe veröffentlichten Buch nehmen Cassirers Überlegungen ihren Ausgang von dem Gegensatz von „Leben und Form“, der ihm gleichbedeutend scheint mit dem von fließender „Kontinuität und Individualität“. Er greift dafür die einleitenden Bemerkungen Georg Simmels aus dessen letztem Werk „Lebensanschauung“ auf, in denen dieser das Sich-selbst-Überschreiten des Menschen, die Überwindung seiner Grenzen und damit das Transzendieren seiner Welt thematisiert. Mit der Lebensphilosophie setzt sich Cassirer auch im Folgenden kritisch auseinander – Simmels Gedanken stand er zwar nicht vorbehaltlos zustimmend gegenüber, aber ihn und noch dazu Henri Bergson und Ludwig Klages, zu denen er viel mehr Abstand besaß, stellt er zwar nicht unkritisch, wohl aber ohne jede Polemik vor. Besonders Klages, dessen Werk ja durchaus fragwürdige Seiten besitzt, nähert er sich voller Verständnis und mit Verweisen auf dessen Verdienste, um erst zum Schluss seine Kritik zu formulieren. Nicht zuletzt dieser Fähigkeit zu einer immer sachlichen Kenntnisnahme anderer Positionen verdankt sein Werk seinen enormen Reichtum an Gedanken und Ideen. Es gibt nicht viele philosophische Werke, deren Lektüre ähnlich anregend ist.
Warum kommt Cassirer überhaupt auf Simmel, Bergson oder Klages zu sprechen? Was interessiert ihn an dem Gegensatz von Kontinuität und Individualität? Sein frühes Hauptwerk „Substanzbegriff und Funktionsbegriff“ von 1910 beschreibt, wie die Wissenschaft die Abkehr von der sinnlichen Anschauung vollzieht, um mit der Hilfe von Symbolen die Relationen der Welt in den bereits zitierten „Verflechtungszusammenhang“ zu stellen. Hier, in den Notizen zu dem vierten Band, schreibt er über die Wissenschaft: „sie geht nicht auf das Daseiende schlechthin, sondern auf die Ordnung des Seins“. In der ersten Phase seiner Philosophie war das für ihn ein Alleinstellungsmerkmal der mathematischen Wissenschaft, jetzt aber sieht er auch die Fähigkeit der Sprache, seine Welt zu ordnen und ihre Gegenstände zu klassifizieren. Eben damit wird die Kontinuität durchbrochen.
Als das Ziel seiner Anstrengungen gilt ihm zunehmend eine philosophische Anthropologie, wie sie ungefähr gleichzeitig mit der Niederschrift des hier vorgestellten Fragments von Helmuth Plessner und Max Scheler konzipiert wird. Auf Plessners „Stufen des Organischen und der Mensch“, ein naturphilosophisch argumentierendes Werk, geht der Text bereits ein, und zwar weitestgehend zustimmend, wogegen Cassirer Schelers „Die Sonderstellung des Menschen“ in der Zeitschrift „Der Leuchter“ nur als Skizze nimmt, als das Versprechen eines größeren Werkes. Ein solches kündigte Scheler allerdings wiederholt als „Metaphysik“ an, aber wegen seines frühen Todes gelangte es nicht über fragmentarische Vorarbeiten hinaus. „Die Sonderstellung des Menschen“, im Buchhandel seit langem und bis heute als „Die Stellung des Menschen im Kosmos“ zu erhalten, gilt zusammen mit dem Buch Plessners als der Beginn der philosophischen Anthropologie.
Vielleicht war Ernst Cassirer unter den großen Philosophen des 20. Jahrhunderts der fähigste Autor. Wie sehr er von seinen schriftstellerischen Fähigkeiten profitierte, zeigen seine im amerikanischen Exil verfassten Werke, deren deutsche Ausgaben aus dem Englischen übersetzt werden mussten und sich sprachlich in keiner Weise mit seinen früheren Werken vergleichen lassen. Oder mit der ersten hundert Seiten dieses Buches, das dem ganzen Band den Titel gab. Bei der Lektüre gewinnen wir den Eindruck, dass wir es mit einem Autor zu tun haben, dem es nur dank seiner Sprachmächtigkeit gelingt, die erstaunliche Fülle seiner Gedanken zu bändigen. „Der Gehalt des Geistes“, heißt es im ersten Band mit einer Anspielung auf Hegel, „erschließt sich nur in seiner Äußerung“. Diesem Anspruch können alle seine auf Deutsch abgeschlossenen Werke genügen.
Für dieses Buch jetzt gilt: Die ersten einhundert Seiten sind ausformuliert, der Rest des Buches besteht aus Notaten von Gedanken. Man könnte denken, dass die Lektüre solcher Notizen nur für Fachleute interessant ist, aber das ist nicht wahr – der ausgearbeitete Text wäre selbstverständlich viel lesbarer und sicherlich auch noch gedankenreicher geworden, aber selbst in ihrer vorläufigen Fassung lassen sich die Überlegungen dieses Autors nachvollziehen. Ernst Cassirer war eben ein Genie: auf jeder Seite dieses Buches spürt man das. Was diesen Notaten fehlt, ist nur – nur! – das Verbindende, ist die Arbeit des Autors, sie in eine stringente Abfolge von Überlegungen zu gießen, in die für seine Bücher so typische Fülle der Gedanken, und weil – ich wiederhole mich – Cassirer ein Genie war, dürfen wir annehmen, dass er während dieser Arbeit zu einigen Schlussfolgerungen getrieben worden wäre, auf die wir mindere Geister leider nicht von allein kommen.
Ein Autor ist kein Philosoph, wenn er an der Sprache scheitert, an seinem zu geringen Wortschatz oder an seiner Unfähigkeit, auch Nuancen und Details gerecht zu werden. Das war ganz gewiss nicht Cassirers Problem, solange er auf Deutsch schrieb. In seinen Büchern begegnet uns ein Gedankenstrom von unfassbarem Reichtum, in der die schillernde Vielfalt der Gedanken eine Entsprechung in den Belegen findet, ob er diese der Geschichte der Philosophie, der erzählenden Literatur oder der zeitgenössischen Wissenschaft entnimmt. In seinen oft rhythmisch gegliederten und trotz ihrer Komplexität immer gut lesbaren Perioden spiegelt sich die Vielfalt seiner Interessen, aber sie zeigen auch, wie genau dieser Autor hinschauen konnte, wenn er einen Text interpretierte.
Ich möchte an dieser Stelle eine seiner Angewohnheiten vorstellen, welche die Lektüre seiner Bücher so viel angenehmer macht als die Texte von Autoren, die sich knapper oder sogar lakonisch ausdrücken oder die Freude an allerlei dunklen Andeutungen kultivieren. Sehr oft setzt Cassirer, nachdem er einen Gedanken in Worte gefasst hat, einen Gedankenstrich oder ein Semikolon und lässt eine Variation des Ausdrucks folgen: „Erst in der ständigen Berührung mit der empirischen Welt der ‚Tatsachen‘ und in der ständigen Rückwirkung, die sie von hier aus erfährt, vermag sich daher die theoretische Form selbst zu entfalten; vermag sie den ganzen Reichtum ihrer Gestaltungen, ihrer inneren ‚Möglichkeiten‘ aufzuschließen.“ Das sind Wiederholungen, für die wir Leser dankbar sein sollten.
Der Titel – „Metaphysik“ – verwundert umso mehr, als sich Cassirer zuvor gemäß der Tradition der Marburger Schule eigentlich immer gegen die Metaphysik stellte. Aber bereits seine eingangs zitierte Absicht, seine Arbeit auf die „Gesamtarbeit der wissenschaftlichen Philosophie“ zu beziehen, sagt uns, was er unter Metaphysik versteht. Er sucht keinen Sinn „hinter“ den Gegenständen, sondern seine Metaphysik zielt auf eine Zusammenschau, eine Synopsis, es geht darum, die verschiedenen Stränge des Wissens miteinander zu verflechten.
Auch im zweiten Band, in dem Cassirer das mythische Denken behandelt, zeigt er, welche Bedeutung die schöpferischen Aktivitäten des Bewusstseins besitzen. Mythen sind „nicht sowohl Reaktionen auf Eindrücke, die von außen auf den Geist geübt werden, als vielmehr echte geistige Aktionen.“ So tritt dem Eindruck der Ausdruck als die Leistung des Bewusstseins gegenüber. Es handelt sich also um eine Wechselbeziehung, bei der noch eine leichte Überlegenheit des Geistes an den ursprünglichen Idealismus des Autors erinnert: „Der metaphysische Dualismus beider erscheint überbrückt, sofern sich zeigen läßt, daß gerade die reine Funktion des Geistigen selbst im Sinnlichen ihre konkrete Erfüllung suchen muß“. So können wir ästhetische Formen überhaupt nur deshalb wahrnehmen, weil wir sie selbst zuvor produzieren und auf unsere Wahrnehmungen projizieren.
Cassirer geht auf die „natürliche Symbolik“ zurück, „auf jene Darstellung des Bewußtseinsganzen, die schon in jedem einzelnen Moment und Fragment des Bewußtseins notwendig enthalten oder mindestens angelegt ist“ (41), um auf dieser Basis die artifizielle Symbolik der Sprache, der Kunst oder der Mythologie zu verstehen. Für Cassirer ist es eine Selbstverständlichkeit, „daß die Grundfunktion des Bedeutens selbst schon vor der Setzung des einzelnen Zeichens vorhanden und wirksam ist“ (1, 42). Damit sind es „Prägungen zum Sein“ (1, 43), denn kein Symbol zielt auf die ähnliche Abbildung einer Wirklichkeit. Es ist kein Bild. Cassirer als dem Philosophen der symbolischen Formen kommt es allein auf den Zusammenhang der Symbole an, der die Einheit der Wirklichkeit (des Seins) erst herbeiführt.
Für alle, die die „Philosophie der symbolischen Formen“ bereits kennen, sollte dieser vierte Band trotz seines fragmentarischen Charakters die Lektüre abrunden; und für alle anderen könnte er ein guter Grund sein, endlich die Lektüre der drei Bände nachzuholen.
Ernst Cassirer: Zur Metaphysik der symbolischen Formen.
Herausgegeben von John Michael Krois unter Mitwirkung von Anne Appelbaum, Rainer A. Bast, Klaus Christian Köhnke und Oswald Schwemmer.
Felix Meiner 2024
416 Seiten
IDBN 978-3787345786
Weitere Informationen (Verlag)
Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen.
Herausgegeben von Birgit Recki.
Felix Meiner 2023
Drei Bände. 1298 Seiten
ISBN 978-3787343553
Weitere Informationen (Verlag)
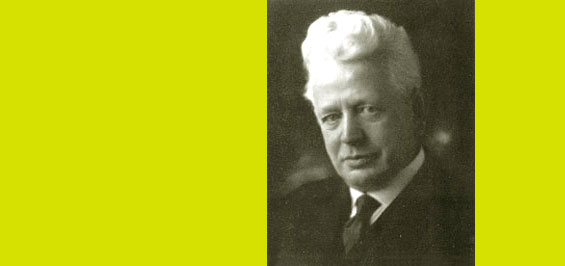
Kommentar verfassen
(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)
Kommentare powered by CComment