Nein, nicht alle Deutschen waren oder sind Karl May-Leser, aber noch heute, so lange nach seinem Tod, dürfte die Anhängerschaft des sächsischen Homer gigantisch sein. Und so kennt den Namen Winnetou fast jeder.
Winnetou ist der Typ des edlen Wilden, ein begabter Mensch, der sich trotz der ungünstigen Umstände seiner Geburt zu einem kultivierten Individuum entwickeln konnte. Ohne Hilfe von außen wäre das natürlich niemals möglich gewesen – Apachen mochten gute Menschen sein, aber Kultur war nicht ihre Sache, und so waren sie dringend auf einen Kulturbringer aus dem Land der Dichter und Denker angewiesen. So dachte der Dichter am Schreibtisch seiner Villa Bärenfett, und so denken noch heute viele.
Ein Kulturbringer musste her, jemand, der den Apachen die einzige und wahre Religion lehrte. Dieses Individuum wurde von seinem Erfinder „Klekih-Petra“ (dt.: „Weißer Vater“) genannt und war ein Deutscher, der nach der Märzrevolution und den Barrikadenkämpfen 1848 in die USA fliehen musste, um sich dort doch noch aus einem Demokraten in einen anständigen Menschen zu verwandeln, indem er die Wilden aus dem Stamme der Apachen zur Kultur emporhob. Karl May (1842-1912), der für eine katholische Zeitschrift schrieb, goss eine ideologische Soße über seine Indianergeschichten, die man nur schwer erträglich findet, wenn man sie endlich durchschaut hat. Kleine Jungs können das noch nicht, aber manchmal greifen ja auch noch große Jungs zu Indianergeschichten…
Im Fall „Klekih-Petra“ ging es May um dessen Atheismus in seinem früheren, sündenbehafteten Leben. „Mein größter Stolz“, berichtet „Klekih-Petra“ über sich, „bestand darin, Freigeist zu sein, Gott abgesetzt zu haben, bis auf das Tüpfel nachweisen zu können, daß der Glaube an Gott ein Unsinn ist.“ Dafür ließ Karl May „Klekih-Petra“ im Wilden Westen Buße tun, wo er Winnetou und dessen Stammesbrüdern den alleinseligmachenden Glauben an Gott lehrte. Dass die Apachen auch ohne einen weißen Lehrmeister eine Religion besitzen könnten, vielleicht gar eine bewahrenswerte, dieser Gedanke kam einem Europäer kaum in den Sinn.
Warum wir auf „Klekih-Petra“ zu sprechen kommen, bevor wir uns zwei Büchern über die Geschichte der wirklichen Indianer zuwenden wollen? Weil sich in den „Reiseerzählungen“ Mays so ziemlich alle Vorurteile versammeln, die man über Indianer findet; und diese immer noch sehr lebendigen Vorurteile kann man sehr gut mit der Hilfe verschiedener Bücher bekämpfen. In diesem Jahr sind zwei schöne Arbeiten hinzugekommen, die selbst Kennern noch manch Neues vermitteln können.
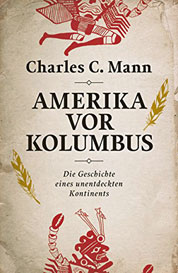 Das erste Buch, eine Übersetzung aus dem Amerikanischen, behandelt die Geschichte beider Amerika vor Kolumbus (vor 1492), das andere, eine Originalausgabe, die Geschichte der Indianer Nordamerikas zwischen 1700 und 1910. Beide Bücher sind sehr empfehlenswert, obwohl die Lektüre traurige Leser zurücklässt. So viele Menschen haben entsetzlich gelitten, so viele Kulturen gingen für immer verloren, so viele Sprachen wurden vergessen! Es scheint unmöglich, aber vielleicht haben die Europäer auf dem Boden der Neuen Welt, die doch die Heimat vieler Menschen war, noch mehr Unrecht begangen als in Afrika. Wurden die Menschen auf dem Schwarzen Kontinent entführt und versklavt, so wurden die Indianer gemordet und teilweise für immer vernichtet.
Das erste Buch, eine Übersetzung aus dem Amerikanischen, behandelt die Geschichte beider Amerika vor Kolumbus (vor 1492), das andere, eine Originalausgabe, die Geschichte der Indianer Nordamerikas zwischen 1700 und 1910. Beide Bücher sind sehr empfehlenswert, obwohl die Lektüre traurige Leser zurücklässt. So viele Menschen haben entsetzlich gelitten, so viele Kulturen gingen für immer verloren, so viele Sprachen wurden vergessen! Es scheint unmöglich, aber vielleicht haben die Europäer auf dem Boden der Neuen Welt, die doch die Heimat vieler Menschen war, noch mehr Unrecht begangen als in Afrika. Wurden die Menschen auf dem Schwarzen Kontinent entführt und versklavt, so wurden die Indianer gemordet und teilweise für immer vernichtet.
Es ist ein Riesenstoff, den ein Historiker des Amerika vor Kolumbus zu bewältigen hat, denn die Geschichte der großen Andenkulturen oder der mittelamerikanischen Reiche unterscheidet sich mehr als deutlich von den Prairie- oder Waldindianern Nordamerikas und den Stämmen Amazoniens oder den Boot-Indianern Feuerlands. Wie will man da auf einen Nenner bekommen? Es ist fast unmöglich, und Charles C. Mann (*1955) hat es in „Amerika vor Kolumbus“ auch nicht wirklich geschafft. Aber kann man ihm daraus einen Vorwurf machen?
Mann folgt den spanischen, portugiesischen und englischen Eroberern und erzählt von deren Entdeckungen und Eindrücken, und erst später berichtet er dem Leser die Ergebnisse der modernen Archäologie, die selten eindeutig sind und so nur erahnen lassen, was alles wir nicht wissen. Was der Leser bei einem solchen Verfahren nicht erwarten darf, ist eine gesicherte Chronologie mit einer Abfolge von Reichen und Herrschern mit Namen und Gesicht, aber darauf kommt es nun wirklich nicht an. Viel interessanter und bedeutender scheint das, was wir über Kultur und Religion, über Landwirtschaft und Küche erfahren.
 Alles war anders. Vor allem besaß Amerika viel mehr Einwohner, als man das gedacht hat, denn obwohl die fürchterliche Bedeutung europäischer Krankheiten seit langem bekannt ist, hat man deren Folgen immer noch unterschätzt. Aber in manchen Teilen Amerikas fielen die Menschen zu mehr als neunzig Prozent Seuchen wie den Pocken oder der Grippe zum Opfer! Viele Epidemien haben ihren Grund in dem engen Zusammenleben mit Haustieren, und weil in Amerika Haustiere fast vollständig unbekannt waren, gab es weder diese Krankheiten noch die entsprechenden Resistenzen. So starben die Indianer wie die Fliegen, oft, bevor sie den Europäern ein erstes Mal begegnet waren. Infizierte indianische Händler oder Boten trugen die Krankheiten von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf.
Alles war anders. Vor allem besaß Amerika viel mehr Einwohner, als man das gedacht hat, denn obwohl die fürchterliche Bedeutung europäischer Krankheiten seit langem bekannt ist, hat man deren Folgen immer noch unterschätzt. Aber in manchen Teilen Amerikas fielen die Menschen zu mehr als neunzig Prozent Seuchen wie den Pocken oder der Grippe zum Opfer! Viele Epidemien haben ihren Grund in dem engen Zusammenleben mit Haustieren, und weil in Amerika Haustiere fast vollständig unbekannt waren, gab es weder diese Krankheiten noch die entsprechenden Resistenzen. So starben die Indianer wie die Fliegen, oft, bevor sie den Europäern ein erstes Mal begegnet waren. Infizierte indianische Händler oder Boten trugen die Krankheiten von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf.
Nicht allein, dass ganz Amerika viel dichter besiedelt war, als man lange geglaubt hat, sondern viele Indianer – auch im Norden! – lebten in Städten, nicht etwa nur in Zeltbehausungen oder kleinen Dörfern. Das Tal des Mississippi zum Beispiel war dicht besiedelt, eine Stadt reihte sich an die andere, und noch sensationeller muss es sein, dass selbst das Amazonasbecken ganzen Völkerschaften Heimat gewesen ist – auch dort fanden sich Städte und unzählige blühende Dörfer. Die Yanomami zum Beispiel lebten vor der Ankunft der Europäer in Dörfern und fielen erst später in den Status von Wildbeutern zurück. Es ist also keinesfalls ein urtümliches Menschentum, denen man in diesen Menschen begegnet.
Man kann gar nicht abschätzen, was der Menschheit mit der Vernichtung der amerikanischen Kulturen verloren ging. Mir scheint besonders die im Vergleich zu Europa und Asien ganz andere Anlage der Städte mit ihren „Mounds“ interessant, mit Erdhügeln, die wahrscheinlich eine symbolische und, damit verknüpft, kultische Bedeutung besaßen.
Die amerikanische Ausgabe dieses Buchs war nicht allein sehr erfolgreich, sondern wurde und wird auch angefeindet. Das hängt mit den Passagen zusammen, in denen der Autor die Natur darstellt. Zunächst behauptet er für Nordamerika, dass die Indianer in grünen Städten lebten und darüber hinaus weite Ebenen in eine Art Garten verwandelten – vor allem geschah dies durch das regelmäßige Abbrennen von Gestrüpp und Unterholz. Deshalb gab es vor der Ankunft der Europäer noch gar nicht die Millionen von Bisons, sondern diese Riesenherden des 19. Jahrhunderts waren nicht etwa Ausdruck einer gesunden Natur, sondern ganz im Gegenteil ein Zeichen für ihr Ungleichgewicht, weil der Mensch nicht mehr pflegend eingriff.
Heftig umstritten ist Manns Darstellung des Amazonasbeckens, denn wenn er recht hat, ist auch der Amazonas-Urwald in seiner heutigen Größe eine Folge der europäischen Einwanderung und der Vernichtung der Kulturen. Auch am Amazonas gab es blühende Kulturen, fanden sich Städte und Dörfer, wurde erfolgreich Landwirtschaft betrieben. Zumindest Teile des Urwaldes wären dann menschengemacht; oder sie entstanden erst nach der Vernichtung der Amazonas-Kulturen. Warum kann man noch heute durch den Dschungel gehen und Obst von den Bäumen genießen? „Der Grund ist, dass Menschen die Bäume gepflanzt haben. Man spaziert durch alte Obstgärten.“ Also gar keine ursprüngliche Wildnis, sondern ein riesiger verwilderter Garten, dessen Boden bis heute mit Keramikscherben durchsetzt ist?
Wird in diesem Buch das Klischee des im Einklang mit der Natur lebenden Urmenschen durch ein ähnliches Klischee ersetzt? Mann zeichnet den Indianer als Gärtner, der mit der Natur viel pfleglicher und schonender umging, als es die Europäer damals taten und die Menschheit heute tut. Auch wenn der Autor es ein wenig übertreiben mag, sind viele Hinweise sehr ernst zu nehmen. So scheint es am Amazonas gelungen zu sein, die unfruchtbare, nährstoffarme Erde in wertvolle schwarze Indianererde zu verwandeln, in „terra preta do Índio“ – nur weiß man bis heute nicht, wie das den Indianern gelungen ist. Man vermutet, dass die Hinzufügung von Holzkohle ein Aspekt dieser Verbesserung war, aber das allein scheint ihre Fruchtbarkeit nicht zu erklären.
 In derselben Weise, in der das Charles C. Mann für das vorkolumbische Amerika gelingt, kann auch das Buch des Schweizer Historikers Aram Mattioli (*1961) den Leser von vielen Vorurteilen kurieren; und seine Lektüre wird ebenfalls traurig machen. Und natürlich sind seine Themen nur teilweise andere. Die schreckliche Rolle der importierten Krankheiten zum Beispiel wird auch von ihm geschildert.
In derselben Weise, in der das Charles C. Mann für das vorkolumbische Amerika gelingt, kann auch das Buch des Schweizer Historikers Aram Mattioli (*1961) den Leser von vielen Vorurteilen kurieren; und seine Lektüre wird ebenfalls traurig machen. Und natürlich sind seine Themen nur teilweise andere. Die schreckliche Rolle der importierten Krankheiten zum Beispiel wird auch von ihm geschildert.
Aber die Seuchen waren nur ein Grund für die Katastrophe der amerikanischen Kulturen. Ein anderer Grund war die außerordentliche Brutalität der Europäer, die einer schon fast ungeheuerlichen Vielzahl von sehr unterschiedlichen, teils tödlich zerstrittenen und dabei immer vergleichsweise kleinen indianischen Nationen gegenüberstanden. Es war leicht, sie zu betrügen, sie abzuschlachten oder wenigstens aus ihren reichen Dörfern zwischen wogenden Feldern zu vertreiben und in öden Halbwüsten („Reservaten“) anzusiedeln. Anfangs, bis weit in das 18. Jahrhundert hinein, gab es auch andere als feindliche Begegnungen, und besonders die Franzosen taten sich im Norden hervor, als sie mit Indianern friedlichen Handel trieben und mit ihnen zusammenlebten. Aber spätestens mit der Gründung der USA wurde die Situation der Indianer aussichtslos. Der Aufstieg dieses Staates ist mit einem Menschheitsverbrechen untrennbar verknüpft, ja, ohne die Vernichtung der indianischen Kulturen hätte es niemals zu einem so reichen Land werden können.
Besonders bitter muten die Schicksale von Indianer-Führern wie dem Shawnee Tecumseh an, der in den Romanen Fritz Steubens gefeiert und auch in Mattiolis Buch angesprochen wird. Hätte dieser charismatische Führer oder hätte sein Vorgänger Pontiac unter günstigeren Umständen seine Nation zu einer kulturellen und politischen Selbstständigkeit führen können? Gab es überhaupt jemals eine Chance dazu?
Im Grunde sind die USA ein Kolonialstaat – das fällt nur deshalb nicht mehr auf, weil die Menschen, die auf dem Boden dieser Kolonie gelebt hatten, fast vollständig ausgerottet wurden. An ihnen wurden Verbrechen der schrecklichsten Art verübt: ob es die Goldgräber in Kalifornien waren, ob Farmer („Frontier“) im Osten, in den „Great Plains“ oder im Süden, ob die reguläre US-Armee: Mit einer unfassbaren Brutalität und mit dem besten Gewissen wurden ganze Nationen ausgelöscht.
 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Indianer bereits ihres gesamten Landes beraubt und in erbärmlichen Reservaten zusammengedrängt. Aber selbst damit war es noch nicht genug, denn jetzt begann eine „reichlich aggressive Assimilationskampagne“, in denen die freien Indianer zu Abziehbildern der Weißen umerzogen wurden – eben deshalb habe ich eingangs „Klekih-Petra“ erwähnt, dessen friedliches Wirken allerdings kaum typisch gewesen ist. Allenfalls seine, bei Lichte betrachtet, wenig löblichen Absichten.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Indianer bereits ihres gesamten Landes beraubt und in erbärmlichen Reservaten zusammengedrängt. Aber selbst damit war es noch nicht genug, denn jetzt begann eine „reichlich aggressive Assimilationskampagne“, in denen die freien Indianer zu Abziehbildern der Weißen umerzogen wurden – eben deshalb habe ich eingangs „Klekih-Petra“ erwähnt, dessen friedliches Wirken allerdings kaum typisch gewesen ist. Allenfalls seine, bei Lichte betrachtet, wenig löblichen Absichten.
Die Werkzeuge für die erzwungene Assimilierung kennen wir auch aus der europäischen, teils sogar der deutschen Nachkriegsgeschichte: Ein Mittel waren Internate, in denen die Kinder, gegen ihren Willen von den Eltern getrennt, zu anderer Kleidung, anderem Essen, anderem Verhalten gezwungen wurden. Oft wurde ihnen sogar der Gebrauch der Muttersprache verboten. Es gab nicht wenige Fälle von Selbstmord, auch starben viele Kinder an Unterernährung oder dank einer mangelhaften medizinischen Versorgung an Infektionskrankheiten.
Mattioli schildert den Untergang der Indianer in einem nüchternen Ton und als Wissenschaftler mit zahlreichen Belegen, weiß aber seiner Empathie für diese Völker trotzdem Ausdruck zu verleihen. Emotional wird er nie, nur gelegentlich sarkastisch oder bitter: „Hunderte von California Indians verloren auch deshalb ihr Leben, damit Rinder, Schweine und Pferde der Neusiedler in ihren ehemaligen Lebensräumen unbehelligt grasen konnten.“ Aber so deutlich er auch die Massenmorde anspricht, mit dem Vorwurf des Genozids hält sich Mattioli auffallend zurück, selbst im Fall Kaliforniens, wo die Indianer – auf einem weniger hohen kulturellen Niveau als viele andere Nationen des nördlichen Amerika – in besonders brutaler Weise ausgerottet wurden. Obwohl damals ganz offen von Ausrottung („extermination“) gesprochen wurde und der junge kalifornische Staat „die Massenmörder für ihr blutiges Treiben“ sogar mit hohen Geldprämien reich belohnte, möchte Mattioli es keinen Völkermord nennen. „In der Praxis“, resümiert er, „lief es auf die Auslöschung der Indianerkulturen, ja auf einen versuchten Ethnozid hinaus.“ Weiter geht er nicht.
Mattiolis Buch ist ganz ausgezeichnet. Es verschont den Leser konsequent mit überflüssigen Grausamkeiten, urteilt differenziert und trotzdem klar, und es behandelt einen sehr umfangreichen Stoff – immerhin mehr als zweihundert Jahre –, in strukturierter Form, ohne sich in Details zu verlieren. Die Lektüre macht traurig, denn wie der Autor sich dem Thema zuwandte, weil er in seiner Jugend für Indianer schwärmte, so werden sich auch viele Leser aus demselben Grund mit diesem Thema beschäftigen, und sie stoßen auf unendlich viel Elend und Hoffnungslosigkeit. „Verlorene Welten“ ist leider ein sehr treffender Titel, denn es gibt nichts, dass uns diese Welten zurückgeben könnte; nicht allein Menschen sind gestorben, sondern mit ihnen sind Sprachen, Sitten, Kulturen untergegangen – für immer.
Ebenso großartig ist das Buch von Charles C. Mann, weil es den ganzen Doppelkontinent in ein anderes Licht stellt. Das fast 80 Seiten umfassende Literaturverzeichnis deutet an, wie seriös der Autor gearbeitet hat, und weil neben der anschaulichen und farbigen Darstellung auch die ruhige und klare Sprache überzeugt, kann man das Buch vorbehaltlos empfehlen. Ich mochte es gar nicht mehr aus der Hand legen.
Charles C. Mann: Amerika vor Kolumbus. Die Geschichte eines unentdeckten Kontinents
Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter
Rowohlt 2016. 720 Seiten
Hardcover und E-Book
ISBN: 978-3498045364
Weitere Informationen
Aram Mattioli: Verlorene Welten. Eine Geschichte der Indianer Nordamerikas 1700-1910
Klett-Cotta, 464 Seiten
ISBN 978-3608949148
Leseprobe
Weitere Informationen
Abbildungsnachweis:
- Buchumschlag: Charles C. Mann: Amerika vor Kolumbus
- Handel mit Indios, Zeichnung um 1600
- Buchumschlag: Aram Mattioli: Verlorene Welten. Eine Geschichte der Indianer Nordamerikas 1700-1910
- Nordamerianischer Indianer, Aufnahme aus dem Jahr 1893. Foto: Bob Bello

Kommentar verfassen
(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)
Kommentare powered by CComment