Politische Diskussionen oder gesellschaftliche Streitigkeiten scheinen heute mehr denn je von Moral bestimmt, aber tatsächlich gehe es bei der Empörung gar nicht um Moral, sondern um Selbstdarstellung, lautet die These Philipp Hübls.
Ziel sei die Präsentation seiner selbst als eines moralischen Menschen. Schließlich, weiß der Autor, habe die Evolution „unseren Geist so geformt“, dass uns Anerkennung über alles geht (schon um der Vermehrung willen…), und sie sei leicht zu erreichen über eine „Erotik der Tugenden“. Wokeness oder sprachliche Hypersensibilität gründeten nicht in ehrlicher Empörung, sondern seien von vornherein nach außen gerichtet und damit Teil des Balzverhaltens. Seine These begründet der Autor auf mehr als dreihundert Seiten, für die er bereits einen renommierten und hoch dotierten Preis erhalten hat, den „Tractatus Preis für philosophische Essayistik“ des Philosophicums Lech. Und auch in Besprechungen kann der Autor breite Zustimmung für sein Buch finden.
Wenn ich nicht auf den Gang, sondern nur auf die Resultate seiner Argumentation schaue, kann ich das gut verstehen. Denn einerseits scheint dem Autor als Ideal ein liberaler Rechtsstaat mit einer angenehmen Gesprächskultur vorzuschweben, andererseits hat er mit seiner Kritik immer wieder recht – recht hat er zum Beispiel, wenn er das Gendern als „Progressivitätsmarker“ bezeichnet oder die missbräuchliche Verwendung vieler Wörter brandmarkt. Was Hübl über den Gebrauch von „Community“, „Narrativ“, „Mikroaggression“ und noch andere modische Begriffe schreibt, ist absolut richtig, und man wünscht sich, er wäre ebenso kritisch mit seinem eigenen Sprachgebrauch umgegangen.

Sprachkritik. Abb.: Pixaline
Sprachkritik ist seinem eigenen Verständnis zufolge das Zentrum der analytischen Philosophie, der er sich selbst zuordnet. Analytische Philosophen, lesen wir in einem seiner früheren Bücher, „streben danach, sich so einfach wie möglich auszudrücken und Fachwörter nur dort zu verwenden, wo es nötig ist. Sie begründen ihre Argumente, wollen Probleme lösen, sind in der Logik geschult und bringen ihre Thesen präzise auf den Punkt.“ Nichtssagender könnte die Vorstellung einer philosophischen Richtung kaum sein. Und natürlich auch nicht positiver, denn Hübl weiß noch einige andere erfreuliche Eigenschaften der analytischen Philosophen aufzuzählen, die mir selbst noch gar nicht aufgefallen waren.
Aber immerhin, mit der Sprachkritik – nicht unbedingt das Zentrum der Philosophie, doch gelegentlich leider notwendig – trifft er ins Schwarze. Und hier liegt auch seine eigene Kernkompetenz. Schlechter steht es mit allen anderen Punkten. Denn tatsächlich ist Hübls Vorgehen in keiner Weise philosophisch. Es ist ein gesellschafts- oder auch zeitkritisches Buch, in dessen Zentrum zahlreiche soziologische Statistiken oder psychologische Studien stehen und das auf diese Weise eine empirisch solide unterfütterte Zeitkritik vorträgt. Wer aber ein philosophisches Werk erwartet, der wird sich auf jeden Fall enttäuscht sehen.
Der Rückgriff auf Beobachtungen und Einsichten von Soziologen oder Psychologen ist zweifellos legitim, und die Fülle der zitierten Studien ist beeindruckend, aber die unscharfe Argumentation dieses Autors ist ebenso ärgerlich wie ihre Eindimensionalität. Ausgangspunkt von Hübls sehr einfach gestrickten Begründungen ist etwas, das er „Moralinstinkt“ nennt und als ein Produkt der Evolution behauptet, ohne dass er sich näher darüber äußerte, woher er um die evolutionäre Entwicklung weiß und warum es seine Argumentation stützen würde, wenn dieser Instinkt (der natürlich kein wirklicher Instinkt ist) tatsächlich ein Produkt der Evolution sein sollte.
Kann er es überhaupt sein? Weder wird der Begriff erläutert (was eigentlich ist ein Instinkt? Verträgt sich ein Instinkt mit Moral?), noch bemüht sich Hübl darum, hier biologische Fakten zu liefern. Es müssten schon biologische Fakten sein, denn schließlich ist Instinkt ein Begriff der Biologie – übrigens einer, den viele Fachwissenschaftler lieber vermeiden. Für diejenigen, die ihn benutzen, liegt die Bedeutung des Instinkts entweder in der Erhaltung der Art (der Vermehrung) oder der des einzelnen Lebewesens (der Ernährung und Verteidigung). Moral kommt jedenfalls nicht vor, und es ist vielleicht nicht überraschend, dass jene Lebewesen, die fast ausschließlich von ihren Instinkten geführt werden – die Insekten –, mit Moral wenig zu tun haben. Das einzige moralfähige Lebewesen auf diesem Planeten ist der Mensch, und kein Tier kennt so wenige Instinkte wie er.
Überhaupt ist es vollkommen nichtssagend, die Evolution anzuführen, denn bereits die Tatsache, dass von Instinkten beherrschte Arten überlebten, zeigt ja, dass diese Instinkte nicht schädlich sein können, sondern wahrscheinlich eher nützlich sind. Bei den Insekten sind es vielgliedrige Bewegungsmuster, die sich niemals und unter keinen Umständen ändern, so dass sich die übliche evolutionäre Erklärung – es wird eine schrittweise, unendlich langsame Anpassung vermutet – von selbst erübrigt. Wie könnte sich etwas anpassen, das sich per definitionem niemals ändert? Inwiefern so etwas wie ein Moralinstinkt das Ergebnis der Evolution sein soll, ist unter diesen Umständen schlechterdings unverständlich. Der Ausgangspunkt von Hübls Argumentation steht deshalb nicht etwa auf wackeligen Füßen, sondern im Nichts.
Nur ein Beispiel dafür, wie sinnlos in diesem Zusammenhang manche Sätze daherkommen! Obwohl er sich doch als analytischer Philosoph dazu verpflichtet fühlen sollte, „sich so einfach wie möglich auszudrücken“, sagt er nicht, dass ein Leopard einen „intelligenten Menschenaffen“ überwältigen und töten könnte, sondern formuliert, dass dieser Mensch (also kein Affe!) nicht mehr die Gelegenheit haben wird, „seine Gene weiterzugeben.“ Mit seinem Jargon entlarvt sich der Autor selbst als einen Bewunderer von Richard Dawkins, der auf den merkwürdigen, aber leider sehr erfolgreichen Gedanken kam, Genen Egoismus zuzusprechen („Das egoistische Gen“). Auch auf die mindestens ebenso seltsame Memtheorie desselben Autors bezieht er sich zustimmend.
Wir wollen einmal sehen, wie Hübl zu der Annahme kommt, Moral sei evolutionär zu erklären, und finden einen bloßen Analogieschluss. „Angst und andere Emotionen“, schreibt er, „sind die Feuermelder des Körpers“. Das ist ein gänzlich sinnfreier Satz, der sich jederzeit umdrehen ließe: Unser Leib reagiert emotional auf gewisse Erfahrungen, Wahrnehmungen oder auch Erwartungen, und wenn wir Angst bekommen, dann deshalb, weil wir bereits um die Gefahr wissen. Einen Feuermelder brauchen wir dann doch gar nicht mehr! Und jetzt kommt die Analogie, die sich als Parallele bezeichnet sieht: „Die Parallele zur Moral liegt auf der Hand.“ Inwiefern? Weil, erläutert Hübl, sowohl die Emotionen als auch der Moralinstinkt nach dem Motto verfahren (tun sie das wirklich?), „Übertreibung ist besser als Nichtbeachtung.“ Diese Übertreibungen sind es, die sein Buch anprangert, und in diesem einen Punkt wollen wir ihm wirklich folgen. Übertreibungen sind nichts Gutes. Aber ein philosophisches Buch hätte sich an dieser Stelle – bei der Diskussion der Frage, inwiefern Übertreibungen in der Lebenspraxis nützlich, in moralischer Hinsicht aber schädlich oder moralisch fragwürdig sein können – mit der Bedeutung von „Maß und Mitte“ beschäftigen sollen, und eben dies unterbleibt.
Als analytischer Philosoph stellt Hübl „Instinkt versus Vernunft“ und tut damit so, als gäbe es mit dem Kalkül nur einen einzigen Grund der von ihm erstrebten universalen Moral. Empathie und Emotionen oder die Verpflichtung eines Mitgliedes einer Gemeinschaft, die hergebrachte Sitte um ihrer selbst willen zu respektieren, stellen für ihn keine legitime Grundlage der Moral da, denn die Moral, auf die er zielt, ist eine universale Moral. Unter Vernunft versteht er Besonnenheit, die seit alters her und aus guten Gründen unter den verschiedensten Titeln als eine Tugend gepriesen wird. Das Gegenteil von Besonnenheit, so erklärt Hübl, seien moralische Intuitionen, die aus „einem komplexen Mechanismus in unserem Gehirn aus evolutionär gereiften und kulturell gelernten Regeln“ bestehen. Warum im Gehirn? Sollte etwa mein Gehirn (nicht ich selbst…) moralisch sein? Und: Evolutionär gereift, aber kulturell erlernt? Im Anschluss an diese grandiose Erklärung werden Beispiele für Schnellschüsse gegeben, die mit Moral nichts, sondern nur mit bloßem Verrechnen zu tun haben. Dem schnellen Denken stehe das langsame Denken gegenüber, das anstrengender sei, weil es Konzentration erfordere. Aber es sei dem schnellen Denken überlegen. Hat dieser Autor noch nie davon gehört, dass Genies wie der Inder Srinivasa Ramanujan, ein Mathematiker, der nicht gänzlich unbegabte Albert Einstein und noch einige andere bedeutende Köpfe von Geistesblitzen – ja, heimgesucht wurden? Plötzlich hatten sie verstanden; und dabei schienen sie nicht einmal nachgedacht zu haben. Als anstrengend erwies sich erst das, was später kam, die Ausarbeitung ihrer Intuitionen zu einer geschlossenen Theorie.
In der erzählenden Literatur werden immer wieder moralische Intuitionen vorgestellt. Sehr oft sind es einfache, aber geradeaus denkende und dazu sensible Menschen, die ganz aus sich heraus zu Güte und Gerechtigkeit finden. Ein schönes Beispiel findet sich in Lew Tolstois „Krieg und Frieden“. In diesem Roman wird Nikolaj Rostow als ein durch und durch moralischer Mensch dargestellt – aber auch als ein Hitzkopf, der nicht zu denken liebt. Er, ein ehemaliger Husar und jetziger Gutsbesitzer, handelt richtig „nicht auf Grund kluger Erwägungen, sondern auf Grund von etwas, was stärker als alle klugen Erwägungen“ ist.
Im ersten Teil seines Buches, „Das Statusspiel“ überschrieben, konfrontiert Hübl den in seinen Augen erfreulichen Fortschritt der Menschheit, den er auf eine zuvor „unvorstellbare moralische Revolution“ nach dem 2. Weltkrieg zurückführt – nun, da ist mir wohl etwas entgangen –, mit der pessimistischen Bewertung unserer Situation durch den Mainstream. Er nennt diesen Widerspruch das „große Moralparadox“. Uns gehe es viel, viel besser als jemals zuvor, und wir agierten viel moralischer als in der Vergangenheit, weil die Menschenrechte viel besser geschützt seien.
Worauf gründet Moral tatsächlich? Eigentlich sollte sich ein Philosoph dazu verpflichtet fühlen, dieser Frage nachzugehen, statt eine Antwort beiläufig vorauszusetzen oder sie in einer biologischen Theorie zu suchen. Wenn wir alle Instinkte beiseitelassen und uns ganz auf unsere nüchtern kalkulierende Vernunft verlassen, sind wir dann (bereits dann…) moralische Wesen? Gibt es keine andere Vernunft als die nüchtern kalkulierende? Kennt die Moral keine andere Quelle? Hat dieser Autor noch niemals etwas von der „Logik des Herzens“ gehört, die der große Mathematiker, Physiker und christliche Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) hochhielt, worin ihm einige nicht ganz unbedeutende Geister wie Max Scheler folgten? Sollen wir tatsächlich nur berechnen – von mir aus ganz langsam – und unsere Emotionen tapfer leugnen oder als Instinkte abtun? Oder: Gibt es auch eine Geschichte der Moral, einen Wandel der moralischen Vorstellungen – womöglich zum Besseren –, so dass wir das, was für uns Heutige ein schreckliches Verbrechen ist, Menschen der Vergangenheit oder jenen, denen es heute schlechter geht als uns, eher nachsehen können? Für mich sind das Fragen, die in einem philosophischen Buch berührt werden sollten, die aber von Hübl an keiner Stelle ins Auge gefasst werden.

Unbekannter Künstler: Blaise Pascal (1623–1662) und Totenmaske. Gemeinfrei
Was Hübl in seinem Buch beschreibt und vielfach und überzeugend belegt, ist der Verfall der Öffentlichkeit. Denn wenn jemand die persönliche Empörung in das Zentrum seiner Äußerungen stellt, wenn private Überzeugungen dominieren, wenn nichts weiter ins Feld geführt wird als unbegründete Anklagen, muss das nicht zur Zerstörung der Öffentlichkeit führen? Aber als jemand, der Übertreibungen und Moralhuberei ebenso wenig liebt wie Hübl, möchte ich fragen, ob sie eventuell nicht auch ihr Gutes haben können, indem sie eine breite Öffentlichkeit sensibilisieren? Später dann wird sich eine weniger aufgeregte Art des Diskutierens durchsetzen, und statt einer übertriebenen selbstgerechten Moral setzt sich ein Taktgefühl durch, das die „Hypersensibilisierung“ ersetzt. Könnte das nicht sein? Aufgeregte und selbstgerechte Selbstdarstellung müsste wir doch trotzdem nicht goutieren.
Noch einmal: In vielem kann man dem Autor zustimmen, als Zeitkritik ist „Moralspektakel“ akzeptabel, aber als philosophisches Buch ist diese Arbeit sehr, sehr schwach und keinesfalls preiswürdig.
Philipp Hübl: Moralspektakel. Wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht.
Siedler Verlag 2024
336 Seiten
ISBN: 978-3827501561
- Weitere Informationen und Leseprobe (Verlag)
- Weitere Informationen zum Tractuatus-Preis des Philosophicum Lech
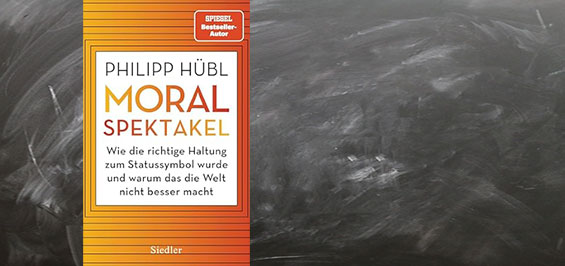
Kommentar verfassen
(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)
Kommentare powered by CComment